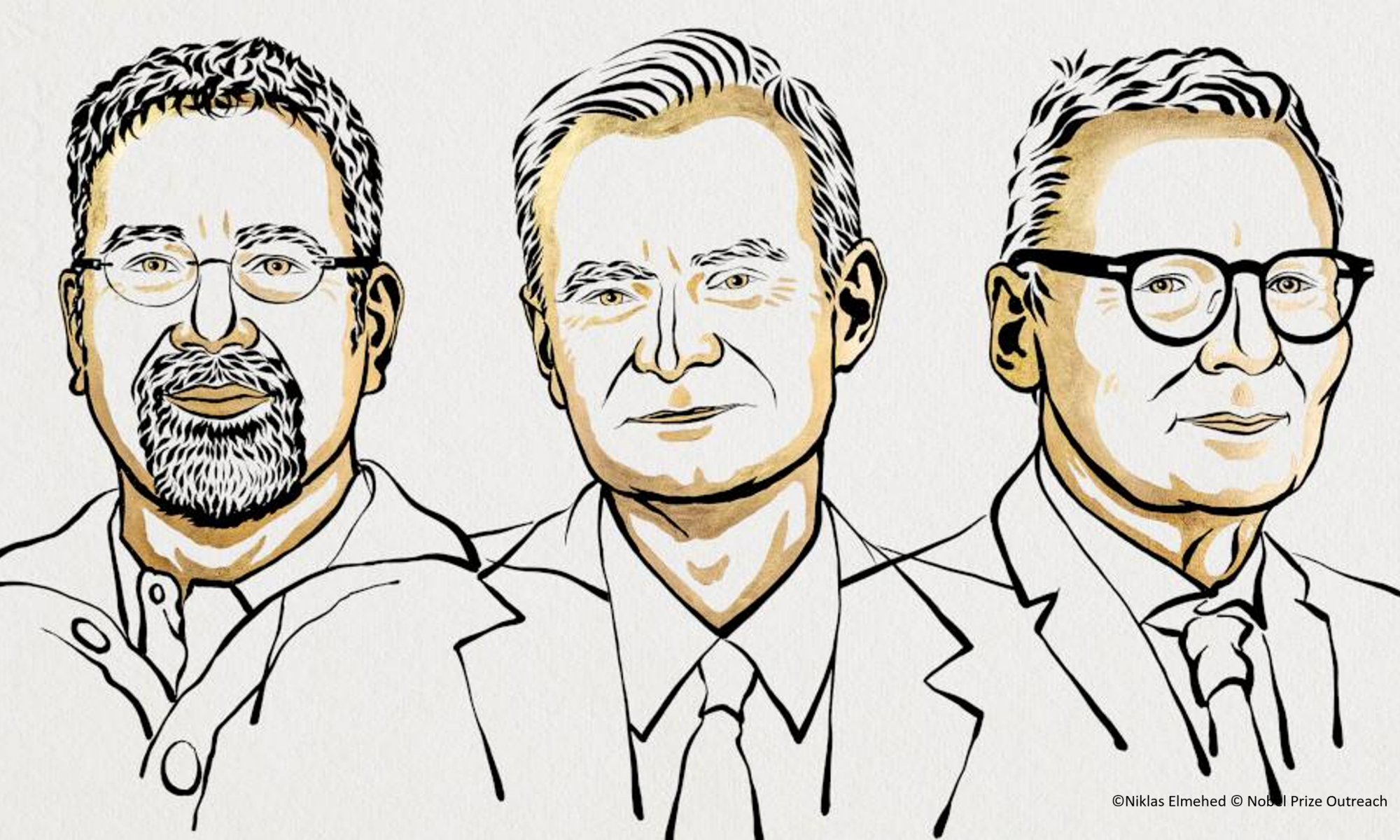Nobelpreis 2024
Wie Institutionen gebildet werden und den Wohlstand beeinflussen
Zum Nobelpreis für Daron Acemoglu, Simon Johnson und James A. Robinson
Dieser Beitrag erläutert die Forschungsbeiträge, für die Daron Acemoglu, Simon Johnson und James A. Robinson im Jahr 2024 mit dem Nobel-Gedächtnispreis für Wirtschaftswissenschaften ausgezeichnet wurden. Gewürdigt werden erstens ihre empirischen Untersuchungen zur Unterscheidung zwischen inklusiven und extraktiven Institutionen mitsamt ihren Auswirkungen auf den wirtschaftlichen Wohlstand sowie zweitens ihr theoretischer Interpretationsrahmen für die polit-ökonomische Logik institutionellen Wandels.