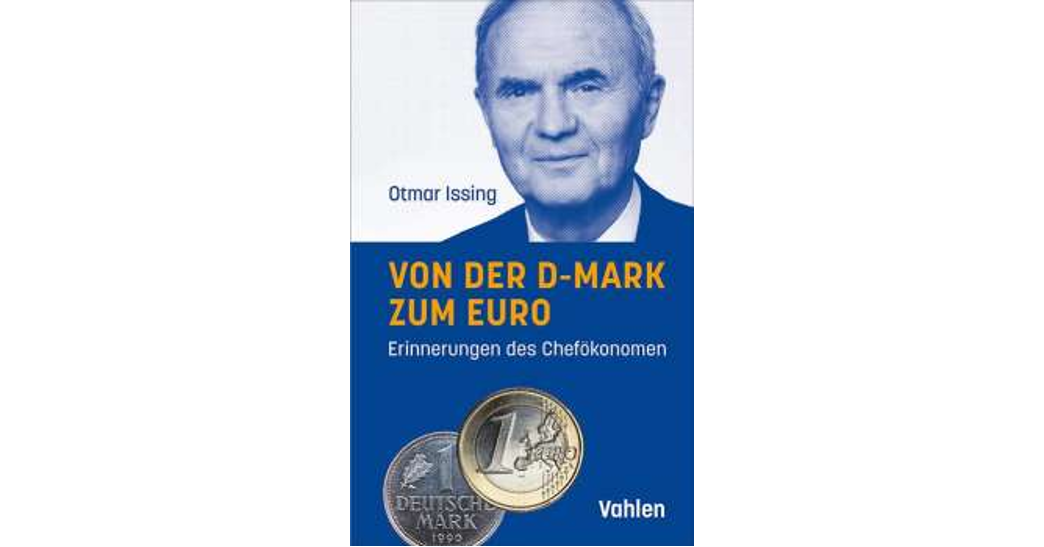Gastbeitrag
Realitätsverweigerung
Unter dem Einfluss multipler Schocks ändert sich die Welt rapide. Die dadurch bewirkte extreme Unsicherheit stellt Politik und Wirtschaft vor gewaltige Herausforderungen. Deutschland ist bisher darauf nur unzureichend vorbereitet.