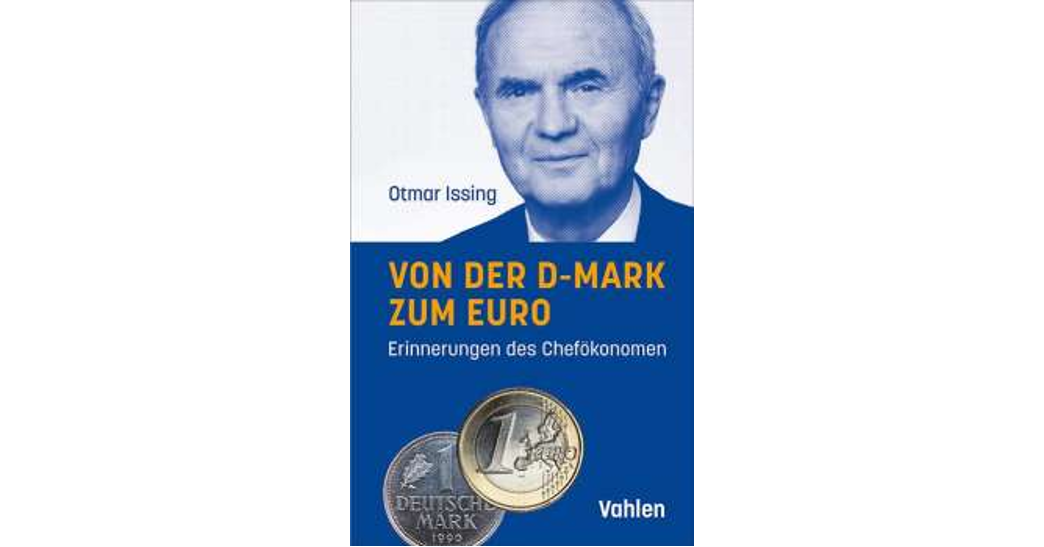Otmar Issing war acht Jahre Chefökonom der Deutschen Bundesbank und für die gleiche Zeitspanne der erste Chefökonom der Europäischen Zentralbank. In seinem Buch „Von der D-Mark zum Euro – Erinnerungen des Chefökonomen“ gibt er tiefe Einblicke in die Hintergründe geldpolitischer Entscheidungen.
Unter diesem Titel habe ich ein Buch zu meinen Erfahrungen als Chefökonom der Bundesbank und der EZB geschrieben. Eingebettet sind die Ausführungen in meinen Lebensweg im Nachkriegsdeutschland.
1.Stabilitätsanker Bundesbank und D-Mark
Im Jahre 1973 nahm ich einen Ruf an die Universität Würzburg an. Die Bezeichnung meines Instituts „Geld und internationale Wirtschaftsbeziehungen“ entsprach meinen wissenschaftlichen Interessen in Forschung und Lehre. Schon bald knüpfte ich Kontakte zu zahlreichen Wissenschaftlern und Institutionen im In- und Ausland. In den Folgejahren wurde ich neben vielen anderen Gremien unter anderem in den Wissenschaftlichen Beirat beim Bundesministerium und schließlich in den Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung berufen. Kurzum, mein Wunsch, Universitätsprofessor zu werden hatte sich mehr als erfüllt. Für mich war es undenkbar, ich könnte mir eines Tages eine andere Tätigkeit suchen und die Universität verlassen. Da erreichte mich ein Anruf des damaligen Präsidenten der Deutschen Bundesbank, Karl Otto Pöhl, der mich zu einem Gespräch einlud. Dieser Kontakt führte am Ende zur Berufung in das Direktorium der Bundesbank. Dort übernahm ich im Oktober 1990 die Verantwortung für die Dezernate Volkswirtschaft und Statistik. Die Möglichkeit, mit der Geldpolitik jetzt Vorstellungen und Überzeugungen umzusetzen, die ich bisher wissenschaftlich bearbeitet hatte, war einfach unwiderstehlich.
Damit wurde ich an herausgehobener Stelle Mitglied einer in Deutschland außerordentlich hoch geachteten Institution.
Bereits im März 1948 war die Bank deutscher Länder als neue Notenbank gegründet worden. Diese wurde dann durch das Gesetz von 1957 durch die Deutsche Bundesbank abgelöst. Die Währungsreform von 1948 markiert einen tiefen Einschnitt in der wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Entwicklung Westdeutschlands. Den Vorgängerinnen der DM-Währung war nur eine relativ kurze Existenz beschieden. Die Mark-Währung wurde im Zuge der Reichsgründung als einheitliches Geld in einem vorher heillos zersplitterten Währungsgebiet eingeführt. Ihr Ende als Goldwährung kam mit dem Ausbruch des Ersten Weltkrieges 1914. Sie ging dann 1923 in der Hyperinflation unter und wurde 1924 durch die Reichsmark abgelöst. Wegen der „gestoppten“ Preise äußerte sich die Finanzierung der Rüstung und des Krieges in einem riesigen Geldüberhang, der dann durch die Währungsumstellung 1948 weitgehend beseitigt wurde.
Zum ersten Mal in einer Generation, die den Verlust des Geldes zwei Mal erleben musste, erfuhren die Deutschen wieder die Vorteile einer stabilen Währung. Auch wenn die DM mit einer durchschnittlichen jährlichen Inflationsrate von 2,8% in den 50 Jahren ihrer Existenz einen nicht unerheblichen Wertverlust zu verzeichnen hatte, galt sie zu Recht (zusammen mit dem Schweizer Franken) als stabilste Währung in der Welt. Die Bundesbank hatte sich als Hüterin der Währung, als Garant stabilen Geldes erwiesen und damit ihr hohes Ansehen, und zwar nicht nur in Deutschland erworben. Der ehemalige Präsident der Europäischen Kommission soll einmal gesagt haben: Nicht alle Deutschen glauben an Gott, aber alle glauben an die Bundesbank.
Meine Aufgabe war es jetzt, die Stabilitätspolitik fortzuführen. Die deutsche Wiedervereinigung löste einen mächtigen Schock aus: Die Inflation stieg, die Leistungsbilanz wechselte von einem hohen Überschuss in ein hohes Defizit, die staatlichen Finanzen liefen aus dem Ruder. Die Bundesbank erhöhte auf meinen Vorschlag hin die Zinsen auf ein Rekordniveau, um einen möglichen circulus vitiosus zu durchbrechen. Die deutsche Wirtschaft geriet in eine schwere Rezession. Nicht zuletzt unter dem Druck der hohen kurzfristigen Zinsen in Deutschland geriet das Währungsgefüge in Europa in eine tiefe Krise. Am Ende ist es der Bundesbank gelungen, das Vertrauen in die Stabilität der D-Mark zu sichern. Dieser Erfolg war umso wichtiger, als sich die für spätestens Anfang 1999 beschlossene Einführung des Euro auf eine stabile deutsche Währung stützen musste.
Im Laufe der nächsten Jahre ging die Inflation stetig in Richtung des Zielwertes von 2% zurück. Die Bundesbank hatte sich wieder einmal erfolgreich als Hüterin der Währung behauptet.
2. Von der Bundesbank zur EZB
Mit dem Beginn der Europäischen Wirtschafts- und Währungsunion im Januar 1999 nahte das Ende der D-Mark, fast genau 50 Jahre nach ihrer Geburt. Während ich mich bereits darauf einstellte, meine Mitarbeiter auf den damit verbundenen krassen Bedeutungsverlust der Bundesbank vorzubereiten, versuchte Präsident Tietmeyer mich davon zu überzeugen, ich sei der einzige Kandidat aus Deutschland für das Direktorium der künftigen Europäischen Zentralbank (EZB), an dem man bei der Benennung des Chefökonomen nicht vorbeikomme. Dies war schließlich die entscheidende Position, wenn es galt, den Kurs der Geldpolitik für den Euroraum zu bestimmen. Sein Bemühen, Bundeskanzler Kohl und Finanzminister Waigel von seinem Vorschlag zu überzeugen, stieß zunächst auf wenig Gegenliebe. Wie mir Tietmeyer erläuterte, löste ein neuer „Anlauf“die Frage des Bundeskanzlers aus: Wie können wir diesen Professor vorschlagen, hat der jemals etwas Gutes über den Euro gesagt? Er habe geantwortet: Wahrscheinlich nicht. Falls er aber annimmt, wovon ich noch nicht überzeugt bin, wird er die beste Wahl sein.
Am 2.Mai 1998 fand das entscheidende Treffen der Staats- und Regierungschefs statt, auf dem die Entscheidung über das erste Direktorium der EZB getroffen werden musste. Einstimmigkeit war die Voraussetzung. Über die Ernennung des Präsidenten gab es ein unwürdiges Gezerre aller anderen mit dem französischen Staatspräsidenten Chirac bis schließlich Wim Duisenberg bestimmt wurde. Die Amtszeit der Mitglieder des Direktoriums beträgt grundsätzlich acht Jahre, Wiederernennung ist ausgeschlossen. Da sonst alle Mitglieder auf einmal nach acht Jahren ausgeschieden wären, wurde für den Start ein abgestuftes Verfahren vorgesehen: Präsident acht, Vizepräsident vier und die übrigen Direktoriumsmitglieder fünf, sechs, sieben und acht Jahre. Ich erhielt einen Vertrag über die längstmögliche Amtszeit, die mir von Beginn an eine besondere Stellung einräumte, zumal der Präsident schon nach 4 Jahren ausschied.
Zunächst mussten sich alle sechs Mitglieder des Direktoriums nach der Beantwortung schriftlicher Verfahren einer Anhörung im Europäischen Parlament unterziehen. Das gab mir die Möglichkeit, meine Position zum Projekt einer Europäischen Währungsunion zu erklären. Der Authentizität wegen zitiere ich dazu aus dem Eingangsstatement, das ich als Kandidat für das Direktorium der EZB am 7. Mai 1998 bei der Anhörung vor dem Europäischen Parlament abgegeben habe. Über den persönlichen Aspekt hinaus beleuchten diese Ausführungen auch den Hintergrund des europäischen Integrationsprozesses.
„Ich möchte […] diese Eingangsbemerkungen nutzen, um meine grundsätzlichen Auffassungen zur Bedeutung der Wirtschafts- und Währungsunion darzulegen. Vorausschicken möchte ich, dass die Wirtschafts- und Währungsunion für mich keineswegs nur ein technokratisches Vorhaben ist.
Mein erster Eindruck einer Währungsunion stammt aus einer Zeit, in der ich von Wirtschaft nichts verstanden und mich für Wirtschaft noch gar nicht interessiert habe. Es ist ein Bild des Kaufmannes, der in Rom aufbrach, nach Colonia Claudia Agrippinensis, dem heutigen Köln, reiste und auf dem ganzen langen Weg mit einer Münze, nämlich dem Denar, bezahlte. Übrigens – wenn er gewollt hätte, hätte er auch das jenseits des Kanals tun können. Die Pax Romana hat den politischen Zusammenhalt gewahrt, die Knappheit des Geldes die Stabilität der Währung. Welches Schicksal hat Europa in den Jahrhunderten danach genommen?
Jemand, der wie ich 1936 geboren ist, der durch die Trümmer seiner völlig zerstörten Heimatstadt zur Schule gegangen ist, durfte dann erleben, wie sich die Grenzen in Europa geöffnet haben, wie das freie Reisen zumindest im westlichen Teil Europas zur Selbstverständlichkeit wurde. Er konnte die Vielfalt der europäischen Kultur an den Originalorten erleben, und er konnte Freunde in Ländern gewinnen, in denen nach den Büchern der Schulzeit angeblich der Feind wohnte.
Diese Erfahrung hat mein Geschichtsbild geprägt. So war es eigentlich ganz logisch, dass ich mich mit dem Studium der Wirtschaftswissenschaften sehr bald auch mit Fragen der europäischen Integration beschäftigt habe. Der Abbau aller Handelsschranken, die Freizügigkeit der Personen, kurzum, die vier großen wirtschaftlichen Freiheiten waren das große Ziel, das sich dann mit dem einheitlichen Markt verwirklicht hat. Ich will nicht verhehlen, dass ich in Sachen Währungsunion zurückhaltender war, zwar nie gegenüber dem großen Ziel, das immer der Endpunkt, die Vollendung der Integration war, wohl aber in Sorge vor dem großen Sprung. In Sorge deswegen, weil ich weiß oder zu wissen glaube, was Währungsunion bedeutet, welche Konsequenzen sie für viele Bereiche von Wirtschaft und Politik jenseits des Monetären hat. Diese Sorge ist sehr viel geringer geworden angesichts der großen Konvergenzfortschritte, die die 11 Mitgliedsstaaten in den letzten Jahren gemacht haben. Ich hätte es offen gestanden nicht für möglich gehalten, dass Europa – das Europa der Elf, von dem wir hier sprechen – vor Beginn der Währungsunion praktisch Preisstabilität erreicht und dass Deutschland mit seiner Inflationsrate sich bestenfalls im Mittelfeld befindet! Eurostat hat vor wenigen Tagen die Inflationsrate für den März bekanntgegeben: 1,2 %. Das ist Preisstabilität!
Die Sorge ist aber nicht völlig beseitigt, denn nicht auf allen Feldern der Wirtschaft kann Europa ähnliche Konvergenzfortschritte verzeichnen. Hier stehen noch große Aufgaben vor uns. Der Internationale Währungsfonds, der dem Vorhaben Währungsunion ja nun geradezu euphorisch gegenübersteht, hat beispielsweise in seinem World Economic Outlook vom Herbst letzten Jahres auf den Reformbedarf verwiesen, die Reformen, die erfüllt werden müssen, damit der Euro das große Potential, das in ihm liegt, auch ausschöpfen kann. Dazu bedarf es vor allem entsprechender Maßnahmen, damit die abschreckend hohe Arbeitslosigkeit in Europa abgebaut werden kann.
Die Einführung des Euro wird das Gesicht Europas prägen. Die Einführung des Euro ist das bedeutendste Ereignis in der internationalen Geld- und Finanzwelt seit dem Ende des 2. Weltkrieges. Von der D-Mark zum Euro
Der Euro wird die ihm zugedachte Rolle nur spielen können, wenn er eine stabile Währung wird. Um dies zu erreichen, gibt der Maastrichter Vertrag der Europäischen Zentralbank einen klaren Vorrang für das Ziel der Preisstabilität und stattet die für die Entscheidung Verantwortlichen mit Unabhängigkeit aus, damit sie die dafür notwendigen Entscheidungen treffen können.
Eine Währung lebt vom Vertrauen der Bevölkerung in die Stabilität des Geldes! Vertrauen in die Stabilität, in die Glaubwürdigkeit der Politik wirkt sich aus in niedrigen Zinsen, höheren Investitionen und mehr Beschäftigung. Das ist der Beitrag der Geldpolitik. Dieses Vertrauen muß hart erarbeitet werden, und wir können im Vorfeld der Währungsunion nun registrieren, dass der Euro von den Finanzmärkten bereits einen bemerkenswerten Vertrauensvorschuß erhält. Dieses Kapital gilt es zu nutzen. Ich bin der festen Überzeugung, dass zur Festigung bzw. zum Aufbau der Glaubwürdigkeit der Europäischen Zentralbank Transparenz ihrer Politik und Offenlegung der Gründe für ihre Entscheidungen gehört. Die Europäische Zentralbank schuldet der europäischen Öffentlichkeit Rechenschaft über die Gründe für die Entscheidungen, über ihre Strategie, über die laufenden geldpolitischen Maßnahmen, und wo könnte der entsprechende Dialog mit der Europäischen Öffentlichkeit besser geführt werden als mit dem Europäischen Parlament, den Vertretern der europäischen Länder und Völker?“
Im Gegensatz zur Anhörung meiner Kollegen, unterzog mich der zuständige Ausschuss in den nächsten zwei Stunden teilweise einer Art Verhör. Wie ich später erfahren habe, wollten Abgeordnete aus dem linken Lager den in ihren Augen „stabilitätsbesessenen“ Bundesbanker unbedingt von der EZB fernhalten. Offenbar fanden sie für ihre feindliche Haltung keine Rechtfertigung. Die Abstimmung endete mit dem Ergebnis: 56 ja, keine Gegenstimmen, 3 Enthaltungen. Dazu hat sicher ganz wesentlich der öffentliche Charakter der Anhörung beigetragen, es waren zahlreiche Journalisten anwesend.
Nach dem Maastricht Vertrag war mit der Ernennung der Mitglieder des Direktoriums die EZB zum 1.Juni 1998 gegründet. Dank der Unterstützung durch den Präsidenten erhielt ich die Zuständigkeit für die Generaldirektionen Economics and Research. Wim Duisenberg schenkte mir sein absolutes Vertrauen und ließ mir alle Freiheit in meinen Vorbereitungen für den Start in die Währungsunion, für die nur sieben Monate zur Verfügung standen.
Wie sollte die EZB die Geldpolitik für ein Währungsgebiet mit 11 teils äußerst heterogenen Mitgliedsländern gestalten? Verlässliche Daten würden selbst lange nach Beginn nicht zur Verfügung stehen. Wie würden die Finanzmärkte, Investoren und Sparer auf den Verlust der vertrauten nationalen Währungen reagieren? Fragen über Fragen. Mit hervorragenden Mitarbeitern aus ganz Europa entwickelte ich die sogenannte Zwei-Säulen-Strategie. Informationen aus dem monetär-finanziellen Bereich und der ökonomischen Analyse einschließlich der Projektion über die Inflationsentwicklung bildeten die Grundlage für die geldpolitischen Entscheidungen. Diese wurden dann im EZB Rat getroffen, dem die sechs Mitglieder des Direktoriums, an ihrer Spitze der Präsident, und die 11 Präsidenten der nationalen Notenbanken der Mitgliedsländer angehörten – ein offenbar sehr komplexes Gremium. Die geldpolitische Strategie bewährte sich in der Folgezeit.
Die EZB hat das Versprechen der Politik für einen stabilen Euro eingelöst. Bis heute liegt die durchschnittliche jährliche Inflationsrate unter der für die D-Mark im Verlauf ihrer 50 Jahre.
3. Positive Bilanz meiner achtjährigen Amtszeit
Ungeachtet eines tiefen Falls des Wechselkurses in den ersten Jahren von 1,18 $ beim Start auf 0,83 verliefen die ersten acht Jahre Währungspolitik in vergleichsweise ruhigem Fahrwasser. Die EZB hatte sich als glaubwürdige, ihrem Mandat –Vorrang für die Preisstabilität – verpflichtete Notenbank etabliert. Der nicht geahndete Verstoß Deutschlands und Frankreichs 2003/4 gegen die Defizitregeln des Stabilitäts- und Wachstumspakts war das erste, wenig beachtete Warnzeichen für die mangelnde europäische Kontrolle der Finanzpolitik der Mitgliedstaaten, ein bis heute fundamentaler Schwachpunkt eines Wirtschaftsraums mit einer Währung, einer Notenbank, aber inzwischen 20 weitgehend souveränen Mitgliedstaaten. Das deutliche Auseinanderlaufen der nationalen Lohnstückkosten schon bald nach Beginn war ebenfalls der Vorbote künftiger Spannungen.
Literatur
Issing, Otmar, Der Euro Geburt-Erfolg-Zukunft, München 2008 (Übersetzungen ins Englische und Chinesische).
Issing, Otmar, Von der D-Mark zum Euro, Erinnerungen des Chefökonomen, München 2024.
- Gastbeitrag
Realitätsverweigerung - 11. Dezember 2025 - Das Buch
Von der D-Mark zum Euro
Erinnerungen des Chefökonomen - 12. Juni 2024 - Die Ära Mario Draghi (2)
Mario Draghis Bilanz - 21. Dezember 2019