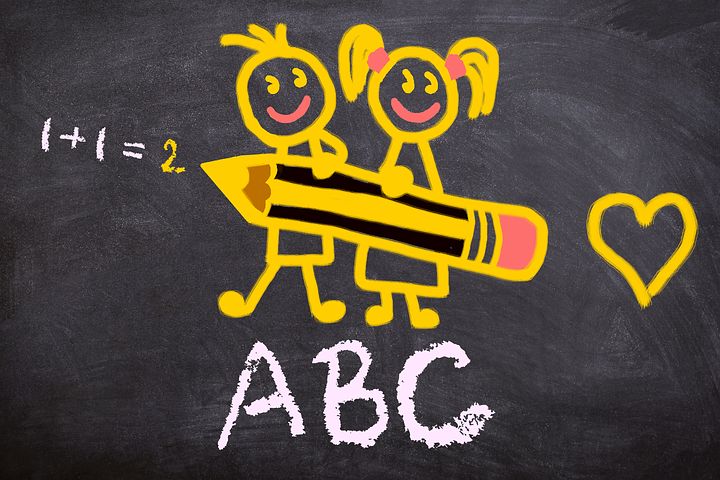Gastbeitrag
Die neue Kindergrundsicherung wiederholt alte Fehler
Nach langem politischem Tauziehen liegt nun ein Gesetzentwurf für die Kindergrundsicherung vor. Die Ziele wurden hoch gesteckt. So verspricht das Bundesfamilienministerium, mit der neuen Kindergrundsicherung …
„Gastbeitrag
Die neue Kindergrundsicherung wiederholt alte Fehler“ weiterlesen