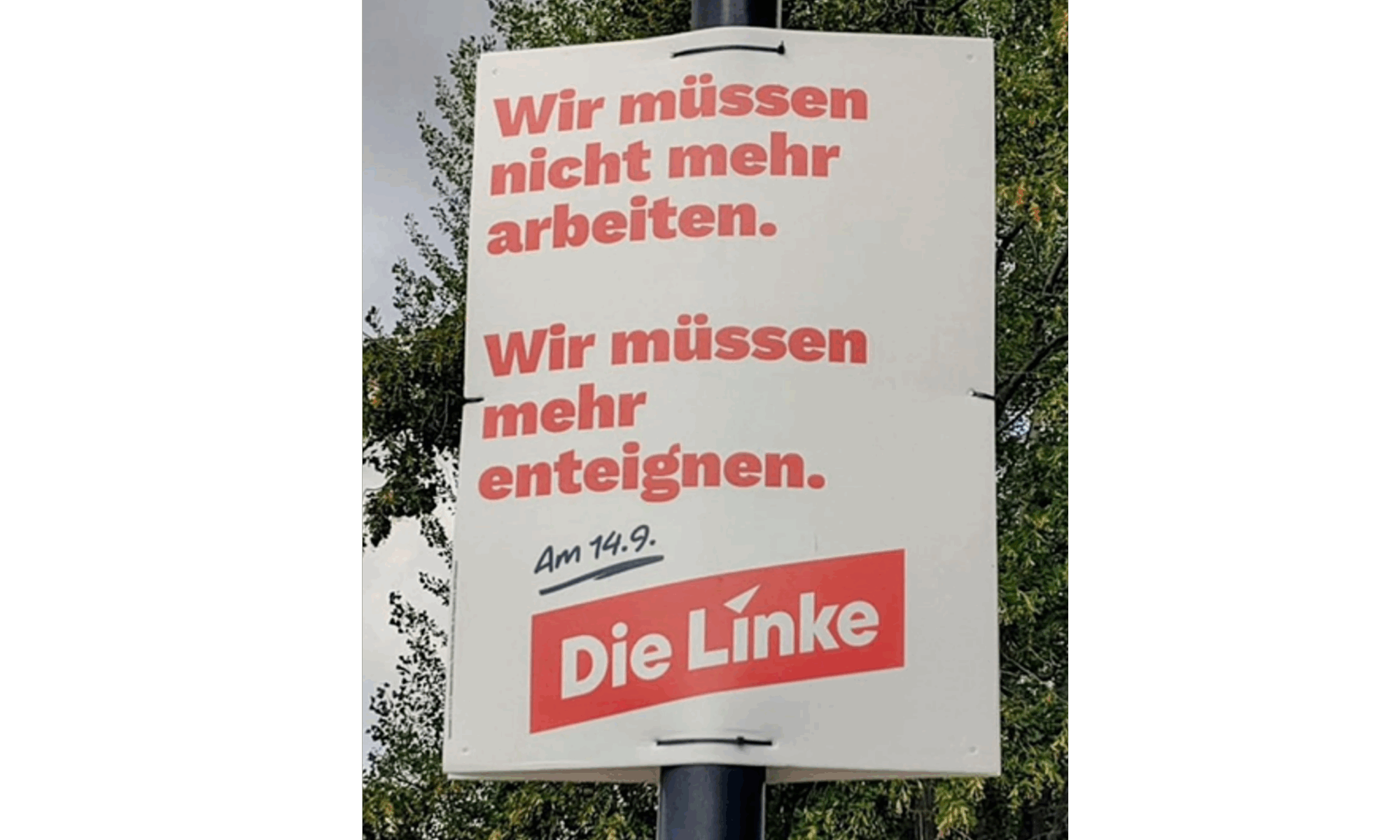Podcast
Gerechtigkeit – Was ist das?
Was ist gerecht, was ist ungerecht? Woran sollte sich eine Gesellschaft orientieren, an der Ergebnis- oder eher der Chancengleichheit? Ist es ungerecht, wenn Einkommen und Vermögen inter-personell (sehr) ungleich verteilt sind? Was ist sinnvoller, um Ungleichheit zu verringern, (noch) mehr staatliche Umverteilung oder eine höhere soziale Mobilität? Woran sollte sich eine Gesellschaft orientieren, die Lasten des demographischen Wandels inter-generativ gerecht anzulasten? Wie sollte sie die umlagefinanzierten Systeme der Sozialen Sicherung reformieren?