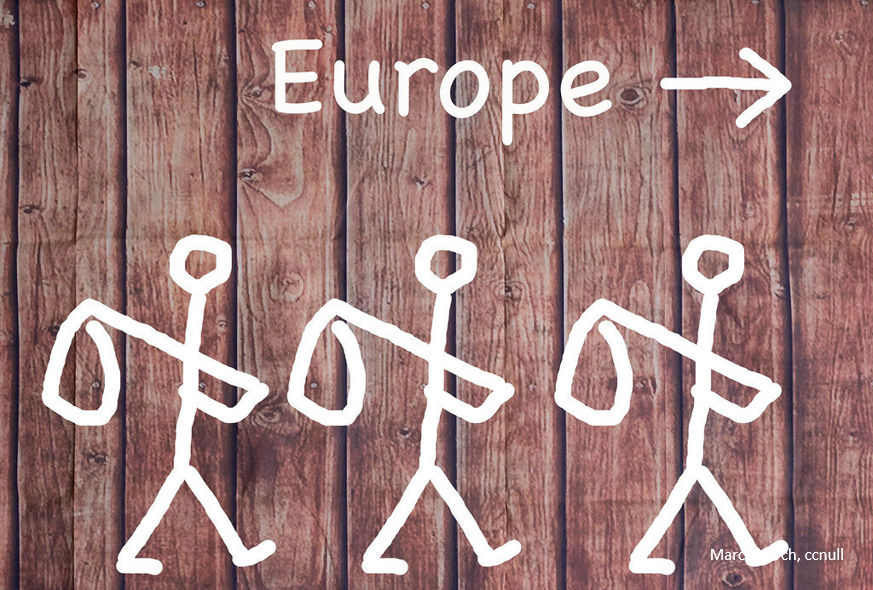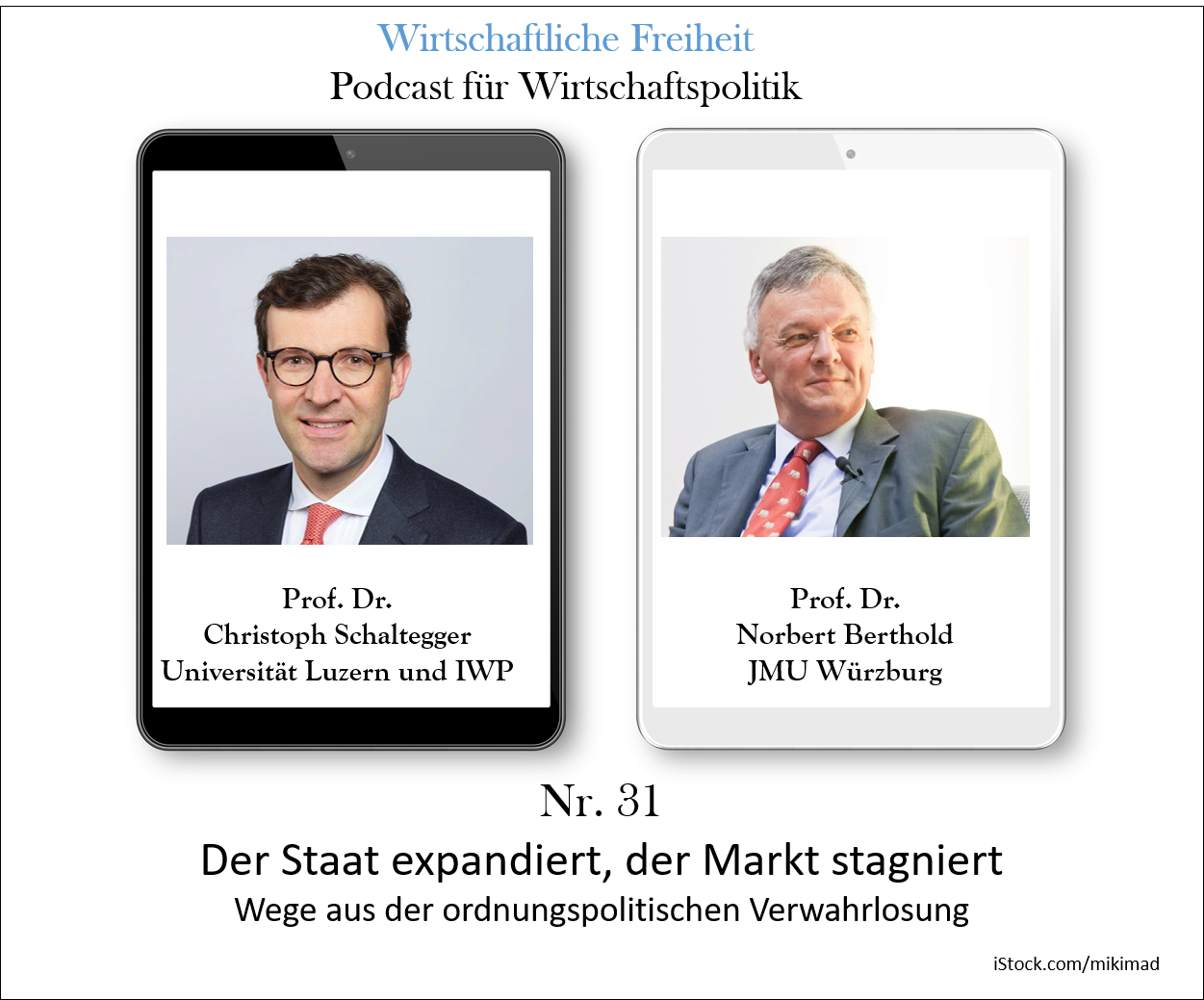Personenfreizügigkeit (4)
Arbeitsmigration in die Schweiz
Es versteht sich von selbst, dass der Nutzen der Zuwanderung für rekrutierende Firmen und rekrutierte Zuwanderer die Kosten überwiegt. Ob dies für den Staat und die Gesellschaft insgesamt ebenfalls zutrifft, ist dagegen offen. Für eine Beurteilung des aktuellen Zuwanderungsregimes der Schweiz ist die Beantwortung dieser Frage allerdings zentral.