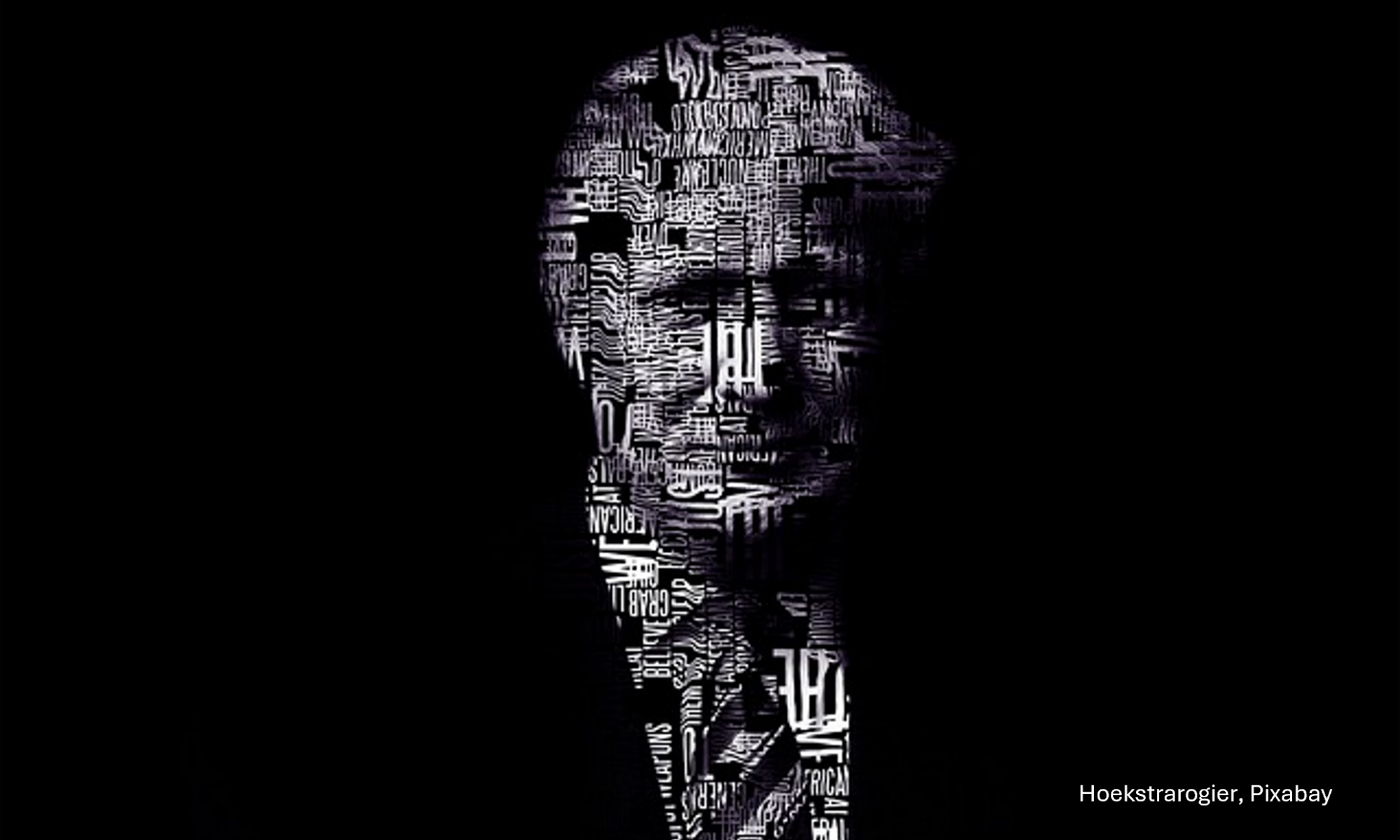Gastbeitrag
Rückkehr der Staatsschuldenkrise?
Die Staatsschulden sind verglichen mit der Wirtschaftsleistung in den meisten großen Mitgliedsländern der Währungsunion bereits höher als vor Ausbruch der Staatsschuldenkrise im Jahr 2010. Nicht wenige Anleger befürchten, dass es irgendwann zu einer neuen Staatsschuldenkrise kommt. Aber das naheliegende Szenario muss nicht das wahrscheinlichste sein.