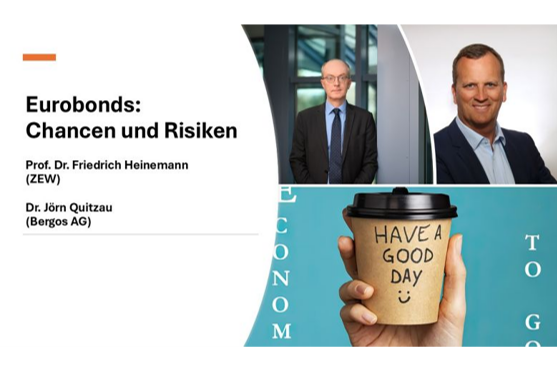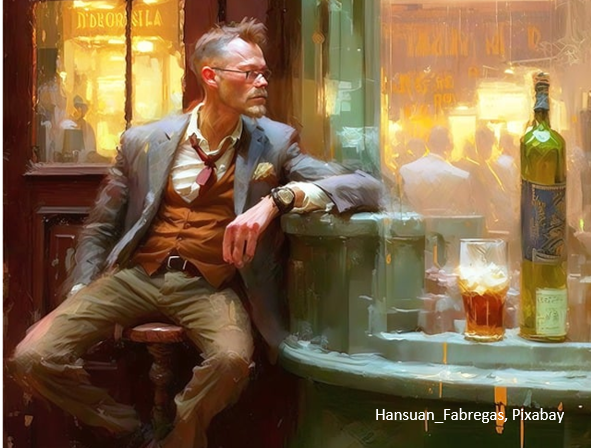(Kurz)Podcast
Eurobonds: Chancen und Risiken
Eurobonds, also europäische Gemeinschaftsanleihen, sind wieder in der Diskussion. Im Regelfall nehmen die Länder Europas ihre Schulden in Eigenregie auf und sind auch für deren Rückzahlung selbst verantwortlich. In den letzten Jahren gab es in Notlagen aber einige Ausnahmen von dieser Regel.