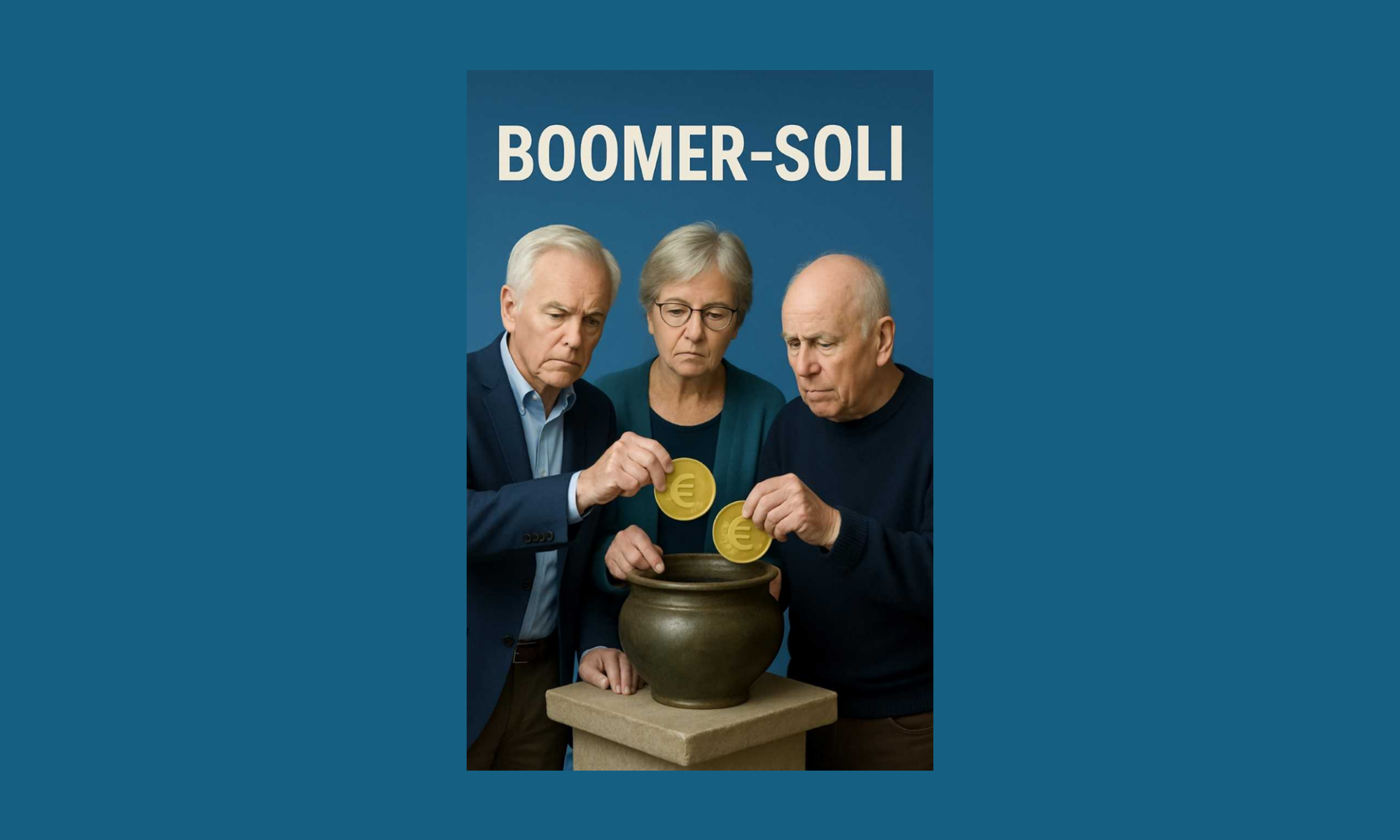Die gesetzliche Rentenversicherung (GRV) steht in Deutschland unter wachsendem fiskalischem Druck. Ursache ist nicht nur der demografische Wandel, der das Umlageverfahren zunehmend aus dem Gleichgewicht bringt. Auch das schwache Wirtschaftswachstum, die stagnierende Erwerbstätigkeit und ein ungenutzte Arbeitsmarktpotenziale führen dazu, dass die erwarteten Beitragseinnahmen hinter den Prognosen zurückbleiben.[1]
Zusätzlich verschärfen politisch beschlossene Leistungsausweitungen den Ausgabendruck. Der aktuelle Koalitionsvertrag sieht unter anderem die Ausweitung der Mütterrente sowie die Verlängerung der Haltelinie beim Rentenniveau von 48?Prozent bis 2031 vor. Beides erhöht die finanziellen Verpflichtungen der GRV, ohne strukturelle Reformen einzuleiten. Das Defizit der Rentenversicherung, das bereits 2025 auf rund sieben Milliarden Euro geschätzt wird, dürfte sich unter diesen Bedingungen weiter vergrößern. Zudem steigen auch die sogenannten impliziten Schulden – also die Summe künftiger Leistungsversprechen, für die bislang keine auskömmliche Finanzierung vorgesehen ist – deutlich an. Diese ansteigende Finanzierungslücke verschärft bestehende Verteilungskonflikte – sowohl zwischen als auch innerhalb der Generationen. Um gegenzusteuern, müssen Einnahmen und Ausgaben der GRV wieder in ein dauerhaft tragfähiges Verhältnis gebracht werden unabhängig von der Hoffnung auf wachstums- oder beschäftigungsbedingte Mehreinnahmen. Der politische Fokus verschiebt sich jedoch momentan von strukturellen Reformen hin zu kurzfristiger Umverteilung – mit wachsender Konfliktintensität zwischen und innerhalb der Generationen. Diese Entwicklung bleibt nicht ohne Resonanz in der wirtschaftswissenschaftlichen Debatte. So schlägt etwa schon der Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung (SVR) in seinem Jahresgutachten 2023/24 eine progressiv ausgestaltete Rentenformel vor, mit der eine stärkere Umverteilung innerhalb der Rentenversicherung erreicht werden soll.[2] Auch das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung (DIW) hat die Diskussion aufgenommen und in einem Papier den sogenannte „Boomer-Soli“ vorgeschlagen, ein neues Umverteilungsinstrument innerhalb der älteren Generationen.
Konzept des Boomer-Solis
Der Boomer-Soli ist ein Solidaritätszuschlag von zehn Prozent auf alle Alterseinkünfte, darunter fallen gesetzliche Renten, Einkünfte aus betrieblicher und privater Vorsorge, Pensionen sowie – je nach Ausgestaltung – auch Kapitaleinkünfte. Die Abgabe soll oberhalb eines monatlichen Freibetrags von rund 1.000 Euro greifen. Die Einnahmen würden in ein zweckgebundenes Sondervermögen fließen und ausschließlich zur Unterstützung einkommensschwacher Ruheständler verwendet. Laut DIW soll der Boomer-Soli dabei nur innerhalb der älteren Generation wirken. Modellrechnungen des DIW zufolge könnte das Nettoäquivalenzeinkommen mit Berücksichtigung der Kapitaleinkünfte im untersten Quintil der Rentnerhaushalte um elf Prozent, im zweiten Quintil um 2,9 Prozent ansteigen, während wohlhabendere Rentner rund 0,6 bzw. 2,5 und vier Prozent (im 3., 4. und 5. Quintil) Einbußen hinnehmen müssten.[3]
Ziel des Boomer-Solis ist es, dass „Risiko von zu geringen Renten und Altersarmut“[4] zu vermindern und zugleich zu verhindern, „die anstehenden Lasten des demografischen Wandels vor allem den jüngeren Generationen aufzubürden“. Der „Boomer-Soli kann deutsches Rentensystem stabilisieren“.[5]
Was auf den ersten Blick nach einem generationengerechten Ansatz klingen mag, der wohlhabendere Ruheständler stärker in die Verantwortung nimmt, entpuppt sich bei genauerem Hinsehen als Kohortenabgabe mit fragwürdiger Systemlogik. Drei Argumente, warum Zielsetzung und Instrument des Boomer-Solis nicht überzeugen:[6]
1. Zielverfehlung: Umverteilung statt Strukturreform
Das Zieldes Boomer-Solis – die Bekämpfung von Altersarmut – mag grundsätzlich berechtigt sein. Es ist jedoch zu betonen, dass er nicht zur Stabilisierung der GRV beiträgt, sondern ein eigenständiges Umverteilungsinstrument innerhalb der Generation der Ruheständler ist. Die bestehenden strukturellen Herausforderungen, insbesondere die demografisch bedingte Schieflage zwischen Beitragszahlenden und Leistungsempfängern, werden durch die Boomer Soli weder gemildert noch adressiert. Statt struktureller Reform schlägt das DIW somit eine neue Transferleistung vor, die einkommensstärkere Ruheständler belastet, um einkommensschwächere Ruheständler zu unterstützen. Damit handelt es sich um eine sozialpolitische Leistungserweiterung außerhalb des beitragsfinanzierten Rentensystems – also um eine Ausweitung des Sozialstaats mit neuen Transferleistungen, nicht um eine Reform zur Sicherung der langfristigen Tragfähigkeit.
Auch das Ziel der Entlastung der jüngeren Generationen ist als politische Aussage nachvollziehbar und grundsätzlich erstrebenswert. Der Boomer-Soli entlastet junge Beitragszahler jedoch nicht. Im Gegenteil: Durch die zusätzliche Abgabe auf Alterseinkünfte setzt der Vorschlag schon im Erwerbsleben negative Arbeitsanreize, die das Arbeitsangebot sinken lässt.[7] Zudem wird durch das nachträgliche Eingreifen das Vertrauen in die private und betriebliche Altersvorsorge geschwächt und der Anreiz zum Sparen gemindert – also genau die gegenteiligen Anreize, die die Koalition momentan anstrebt. Eine Entlastung der Erwerbstätigen wäre allenfalls indirekt möglich, etwa wenn mit der Einführung des Boomer-Solis die Haltelinie des Rentenniveaus aufgegeben würde und der Nachhaltigkeitsfaktor wieder uneingeschränkt in der Rentenformel wirken könnte. Denn dadurch könnten das Rentenniveau in der GRV sinken. Doch selbst in diesem Fall würden die Beitragszahler nicht unmittelbar entlastet, sondern lediglich der Anstieg der Beitragsbelastung gedämpft werden, aber es wäre immerhin eine positive finanzielle Auswirkung auf die Erwerbstätigen. Beides ist im aktuellen Koalitionsvertrag nicht vorgesehen. Im Gegenteil soll die Haltelinie, wie eingangs erwähnt, im Rentenpaket II sogar bis zum Jahr 2031 verlängert werden.
Aus dem DIW-Vorschlag geht nicht hervor, ob mit den Boomer-Soli eine solche Abkehr von der Haltelinie gefordert wird – und, ob der Vorschlag bereits vor 2031 oder erst danach eingeführt werden soll. Sollte er vor 2031 eingeführt werden, ist folgend keine entlastende Wirkung, auf die Beitragszahler zu erwarten.
Ein Absenken des Rentenniveaus wäre zudem ein Paradigmenwechsel in der gesetzlichen Rentenpolitik: Eine Abkehr von der politisch garantierten Sicherung im Alter durch das Rentenniveau in der ersten Säule, hin zu einer stärkeren sozialstaatlichen Kompensation über abgabenfinanzierte Umverteilung. Das wäre – insbesondere auch für die SPD – ein Bruch mit der bisherigen rentenpolitischen Linie.
2. Instrumentenverfehlung: Missverständnis des Sozialstaatsprinzips
Auch wenn Armutsbekämpfung im Alter als politisches Ziel anzustreben sei, ist der Boomer-Soli in seiner konkreten Ausgestaltung eine konzeptionelle Fehlleitung. Mit der Grundrente und der Grundsicherung im Alter stehen bereits sozialstaatliche Instrumente zur Verfügung, das gezielt auf die materielle Absicherung im Ruhestand abzielt. Über Umfang, Höhe und Reichweite dieses Instruments lässt sich politisch streiten – unzulässig ist jedoch, diese Aufgabe einseitig über eine zusätzliche Abgabe zu finanzieren, die gezielt nur eine gesellschaftliche Gruppe belastet. Die solidarische Finanzierung sozialer Sicherung ist eine gesamtgesellschaftliche Verantwortung im Sozialstaat – keine generationeninterne. Der Vorschlag des DIW durchbricht dabei grundlegende Prinzipien der Rechts- und Sozialstaatlichkeit in mehrfacher Hinsicht: Zum einen droht eine ungleiche Behandlung gleichartiger Kohorten, was mit Blick auf Art. 3 Abs. 1 GG – dem Gleichheitsgrundsatz – verfassungsrechtlich bedenklich ist. Zum anderen greift der Boomer-Soli in bestehende Altersvorsorgestrukturen ein, die unter dem Schutz des Eigentumsrechts nach Art. 14 Abs. 1 GG stehen. Zwar ist im Einzelfall zu prüfen, ob eine solche Belastung rechtlich zulässig wäre, doch unabhängig von der juristischen Bewertung ist das politische Signal problematisch: Wer heute vorsorgt, muss künftig mit staatlichen Eingriffen rechnen. Ein solcher Vertrauensbruch unterminiert nicht nur die individuelle Vorsorgebereitschaft, sondern gefährdet langfristig die gesellschaftliche Akzeptanz des Alterssicherungssystems.
Zudem gilt in der gesetzlichen Rentenversicherung, die ebenfalls von der Abgabe betroffen wäre, das Äquivalenzprinzip: Wer mehr einzahlt, erwirbt auch im Verhältnis höhere Ansprüche. Dieses zentrale Prinzip wird durch eine pauschale Zusatzbelastung konterkariert. Der Vorschlag des DIW ersetzt das beitragsorientierte Prinzip der GRV durch redistributive Logiken wie sie dem steuerfinanzierten Sozialstaat vorbehalten sind. Dadurch verschwimmen die Grenzen zwischen beitragsbezogener Versicherung und sozialstaatlicher Umverteilung.
3. Demografischer Wandel verlangt keine altersbezogene Zusatzbelastung
Der demografische Druck auf die Sozialversicherungssysteme ist eine Folge niedriger Geburtenraten. Eine pauschale Belastung des Bommer-Solis von älteren, vermögenden Personen ist daher nicht verursachergerecht. Stattdessen müssten im Sinne des Generationenvertrages in der GRV die Personengruppen stärker belastet werden, die keine Kinder bekommen haben und somit ihren „Vertragsbestandteil“ innerhalb der Versicherungsgemeinschaft nicht erfüllen. Dies betrifft sowohl die Generation der Babyboomer als auch die heutigen Erwerbstätigen. Verursachergerecht wäre es daher, familienpolitische Komponenten stärker in die Finanzierung der Sozialversicherungen zu integrieren – etwa durch Mehrabgaben für Kinderlose.
Generationengerechtigkeit braucht einen struktureller Reformmix
Eine nachhaltiges Reformpaket der GRV erfordert keinen Umverteilungsvorschlag, sondern einen strukturierten Mix aus generationengerechten Maßnahmen auf der Einnahmen- wie auf der Ausgabenseite.
Auf der Ausgabenseite bedeutet das vor allem, die Rentenphase an die steigende Lebenserwartung anzupassen: durch eine längere und zugleich flexiblere Lebensarbeitszeit. Ergänzt werden muss dies durch versicherungsmathematisch faire Abschläge bei vorzeitigem Renteneintritt und eine Anpassung der Rentenformel, insbesondere mit Blick auf die Beitragsjahre des Eckrentners. Auch der Nachhaltigkeitsfaktor sollte wieder uneingeschränkt wirken, um demografische Veränderungen systematisch in der Rentenanpassung zu berücksichtigen.
Auf der Einnahmenseite ist eine breitere Finanzierungsbasis notwendig. Dazu gehört der gezielte Abbau von Erwerbshürden und eine höhere Arbeitsmarktbeteiligung, insbesondere von Frauen und älteren Arbeitnehmern. Zudem sollte der Aufbau eines Kapitalstocks für künftige Rentenverpflichtungen vorangetrieben werden. Das Konzept des Generationenkapitals liegt dafür in der Schublade. Im Sinne des Generationenvertrages und des Verursacherprinzips wären auch, wie im Punkt drei ausgeführt, stärkere Beitragslasten für Kinderlose zu erwägen.
Darüber hinaus müssen die betriebliche und private Altersvorsorge bürokratiearm ausgebaut werden, um eine renditestarke Möglichkeit und Erweiterung der Altersvorsorge zu bieten. So kann ein hohes Gesamtversorgungsniveau über die drei Säulen in Zukunft der Alterssicherung sichergestellt werden.
Entscheidend ist, dass das Äquivalenzprinzip für die Versicherung erhalten bleibt: Leistungen müssen weiterhin in einem nachvollziehbaren Verhältnis zu den eingezahlten Beiträgen stehen. Gleichzeitig müssen die bestehenden Zielkonflikte in der GRV – etwa zwischen hohen Rentenniveau und Beitragsstabilität sowie die Lastenverteilung des demografischen Wandels – offen kommuniziert werden: Die Stabilisierung der gesetzlichen Rente ist eine gesamtgesellschaftliche und politische Aufgabe von hoher Dringlichkeit. Die notwendigen Strukturreformen sollten nicht aufgeschoben, sondern besser heute als erst 2027 im Rahmen einer neuen Rentenkommission eingeleitet werden.
Fazit: Mehr Sozialstaat ist keine Rentenreform
Der Boomer-Soli wäre eine Ausweitung des Sozialstaats mit neuen Transferleistungen – kein Instrument zur Stabilisierung der gesetzlichen Rente. Er trägt nicht zur fiskalischen Nachhaltigkeit bei, sondern fördert einen Verteilungskonflikte innerhalb einer Generation und weicht zentrale Prinzipien der GRV auf. Was stattdessen gebraucht wird, ist ein mutiger, generationengerechter Reformmix: fair in der Lastenverteilung, nachhaltig in der Wirkung und konsistent mit den Grundprinzipien der Sozialversicherung.
Quellen:
Bach, S., Blesch, M. Gehlen, A., Geyer, J., Haan, P., Klotz, S. und Veltri, B. (2025): Ohne direkte Mehrbelastung der Jungen: ‚Boomer?Soli‘ kann wichtiger Baustein für Stabilisierung der Rente sein, DIW Wochenbericht Nr.?29/2025, S.?447–456.
Bundestag (2025): Antwort der Bundesregierung auf die Große Anfrage der Fraktion der CDU/CSU – Drucksache 20/11131 – Stabilität und Nachhaltigkeit der Finanzierung der Sozialversicherung. URL: https://dserver.bundestag.de/btd/20/143/2014319.pdf.
Destatis (2025): Erwerbstätigkeit stagniert auch im Mai 2025. URL: https://www.destatis.de/DE/Presse/Pressemitteilungen/2025/07/PD25_236_132.html.
DIW (2025): „Boomer-Soli“ kann deutsches Rentensystem stabilisieren. Pressemitteilung vom 16. Juli 2025. URL: https://www.diw.de/de/diw_01.c.967996.de/boomer-soli____kann_deutsches_rentensystem_stabilisieren.html.
French, E., A.S. Lindner, C. O’Dea und T.A. Zawisza (2022): Labor supply and the pension-contribution link, NBER Working Paper 30184, National Bureau of Economic Research, Cambridge, MA.
Kindermann, F. und Püschel, V. (2023): Progressive pensions as an incentive for labor force participation, CEPR Discussion Paper DP16380, aktualisierte Version vom August 2023, Centre for EconomicPolicy Research, London.
Rudolph, K. und Quitzau, J. (2025): Der „Boomer-Soli“ – kein geeignetes Rezept zur Stabilisierung des Rentensystems. URL: https://open.spotify.com/episode/0OwQImvRnhyxeSvIKetqFE?si=85b3e8824eb640bf.
SVR – Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung (2023/2024): Wachstumsschwäche überwinden – in die Zukunft investieren. Jahresgutachten 2023/2024. Wiesbaden.
[1] Destatis (2025).
[2] SVR (2023/2024), S. 327.
[3] Bach et. al. (2025), S. 454.
[4] Bach et. al. (2025), S. 448.
[5] DIW (2025).
[6] Basierend auf Rudolph und Quitzau (2025).
[7] Vgl. French et. al. (2022), Kindermann und Püschel., (2023).
Podcasts zum Thema:
Der Boomer-Soli – Kein geeignetes Rezept zur Stabilisierung des Rentensystems
Dr. Jörn Quitzau (Bergos) im Gespräch mit Karen Rudolph (ALU)
Sanierungsfall Sozialversicherungen?! Reformansätze für Renten-, Kranken- und Pflegeversicherung
Prof. (em.) Dr. Norbert Berthold (JMU) im Gespräch mit Prof. Dr. Bernd Raffelhüschen (ALU)