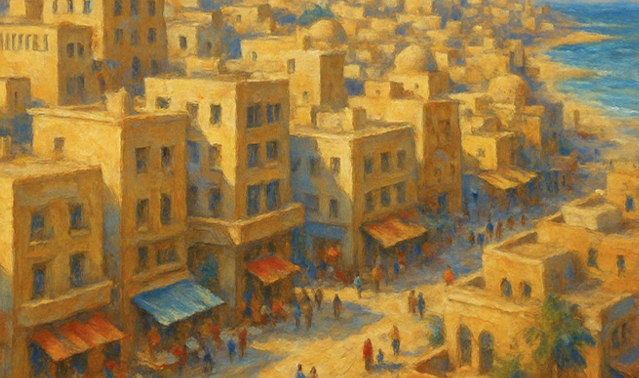Die Lage in Gaza ist kritisch, auch wenn der jüngst von der US-Regierung vermittelte Waffenstillstand eine neue Hoffnung aufkeimen lässt. Nach Jahren schwerster Gewalt und unermesslichen Leids auf beiden Seiten bietet die Waffenruhe seit Langem eine erste, wenn auch fragile, Chance auf Stabilisierung. Sie markiert keinen Frieden, sondern eine Atempause und eine Gelegenheit, um endlich langfristig wirklich tragfähige Lösungen zu entwickeln, die über bloße Krisenverwaltung hinausgehen.
Militärisch ist die ehemals regierende Terrororganisation Hamas weitgehend geschlagen, und ihre Unterstützung durch Hisbollah im Libanon oder das Mullah-Regime im Iran ist versiegt. Doch der Waffenstillstand ist brüchig: Ohne fundamentale institutionelle Erneuerung, ohne klare Perspektiven und ohne glaubwürdige Anreize für alle Entscheidungsträger droht ein Rückfall in Gewalt und Chaos. Jetzt gilt es, dauerhafte institutionelle Strukturen zu schaffen, die den Menschen in Gaza eine Zukunft in Friede, Wohlstand und Selbstbestimmung ermöglichen – und gleichzeitig auch den Nachbarn in Israel Sicherheit garantieren.
Die gängigen politischen Rezepte – allen voran die seit Jahrzehnten beschworene „Zweistaatenlösung“ – sind grandios gescheitert, selbst wenn sich das viele europäische Entscheidungsträger nicht eingestehen wollen. Darüber hinaus bergen die bisherigen Ansätze, ebenso wie eine erneute israelische Besetzung, das Risiko neuer Katastrophen und endloser Konflikte. Was also tun?
Institutionen sind entscheidend
Zunächst gilt es, die Ursachen der schrecklichen Entwicklung zu benennen. Es ist nicht die Natur der großen Mehrheit der betroffenen Menschen, sondern es sind die politischen Rahmenbedingungen. In Gaza konnten die Bewohner nie frei leben und sich entfalten, weil sie unterdrückt und gesteuert wurden. Die Forschung und Erfahrung zeigen: Das Verhalten von Menschen wird entscheidend von den politischen Institutionen geprägt. So war vor dem Koreakrieg der Norden bei sehr ähnlicher Kultur wohlhabender als der Süden. Unterschiedliche politische Institutionen führten seither zu massiv gegensätzlichen Entwicklungen. Ost- und Westdeutschland glichen sich nach der Wiedervereinigung rasch an. Chinesen in Hongkong passten sich ebenso schnell an neue institutionelle Gegebenheiten an – und noch einmal, wenn sie in die USA oder nach Großbritannien zogen. Die große Frage ist also, wie in Gaza bessere Institutionen eingeführt werden können, die den Bürgern mehr Freiheit, Anreize und Möglichkeiten geben, ihre Produktivkräfte zu entwickeln und mit sich und den Nachbarn in Frieden zu leben.
Die naheliegende Standardantwort ist: ein marktwirtschaftliches, demokratisches System installieren. Doch das greift zu kurz. Allzu oft zeigt sich, wie schwer sich Demokratien etablieren lassen, wie häufig vermeintliche Demokratien enttäuschen, und wie rasch sie zu Autokratien degenerieren. Für Gaza schlagen wir deshalb einen anderen Weg vor: die Schaffung mehrerer Stadtstaaten. Alle Stadtstaaten – ob etwas größer oder ganz klein – sind relativ zu ihrem Umland erfolgreich: Singapur, Macau, Hong Kong, die Glieder der Vereinigten Arabischen Emirate oder die Stadtstaaten im Italien der Renaissance. Das gleiche gilt für stadtstaatenähnliche Einheiten wie Monaco, San Marino, Andorra und Liechtenstein. Die große Ausnahme ist das bisherige Gaza. Somit gilt es, drei Fragen zu klären: Weshalb funktionieren Stadtstaaten besser als Flächenstaaten? Weshalb war das in Gaza anders? Was ist dort zu tun?
Der Erfolg von Stadtstaaten
(1) Anreize zu guter Politik. Die Anreize einer Regierung zu guter Politik hängen davon ab, wie rasch ihr „Steuer- und Regulierungssubstrat“, also die Bürger und Unternehmen, auf gute oder schlecht Politik der Regierung reagieren können. In Stadtstaaten geschieht dies schneller als in Flächenstaaten: Die Bürger leben nahe der Grenze, Aus- und Zuwanderer müssen kaum weite Wege zurücklegen, und kulturelle Ähnlichkeiten senken die Wanderungs- und Anpassungskosten. In Stadtstaaten reagiert die Ab- und Zuwanderung von Bürgern und Unternehmen deshalb schneller auf unnötig hohe Abgaben, Regulierungen und Einschränkungen. Selbst eigennützige und teils autokratische Regierungen müssen daher die Steuersätze tief halten und für gute Staatsleistungen und attraktive Rahmenbedingungen sorgen, sodass die Bürger gerne im Stadtstaat leben wollen. Da zudem das Land knapp ist, schlägt sich die Qualität der Politik direkt in den Landwerten nieder – ein starker Anreiz, zumal der Staat oft selbst zu den größten Landbesitzern zählt.
(2) Effizienz statt Umverteilung. Flächenstaaten neigen zu Verteilungskämpfen und Ausbeutung zwischen Regionen, insbesondere zwischen Hauptstadt und Umland. Dies liegt an den Unterschieden hinsichtlich Wirtschafts- und Branchenstruktur sowie sprachlichem, ethnischem, religiösem und kulturellem Hintergrund und so eingeschränkten Wanderungsmöglichkeiten. In Stadtstaaten hingegen ist die Ausbeutung einzelner Stadteile wegen der hohen innerstädtischen Mobilität unattraktiv. Das lenkt den politischen Fokus stärker auf Effizienz und allgemeine Wohlfahrtsgewinne und damit weg von Umverteilung zwischen Stadt und Land.
(3) Bessere Information. Je besser Bürger und Politiker über die gegenseitigen Präferenzen informiert sind und je homogener in ihren Präferenzen sie aufgrund von Selektion durch Wanderung sind, desto besser funktioniert der Staat. Die geographische Nähe in Stadtstaaten erleichtert den Informationsaustausch. Meinungs- und Medienfreiheit sind oft besser gewährleistet. Medienschaffende können bei Einschränkungen leicht ins nahe Ausland ausweichen und von dort weiterarbeiten.
(4) Größere Offenheit. Wirtschaftliche Offenheit ist für Stadtstaaten überlebenswichtig. Entsprechend verfolgen sie meist eine recht liberale Handels- und Wirtschaftspolitiken und nutzen gezielt Standortvorteile, die große Flächenstaaten oft vernachlässigen. Die Politik von Stadtstaaten richtet sich damit auch stärker darauf aus, die Standortattraktivität zu erhöhen.
(5) Nachhaltige Demokratisierung. Die genannten Mechanismen zwingen Regierungen, stärker auf Bürgerpräferenzen zu achten. Politische Macht ist im Stadtstaat weniger wert als im Flächenstaat und wird seltener ausgebaut. Die Regierungen von Stadtstaaten akzeptieren daher eher starke demokratische Rechte und kämpfen gegen Korruption. Selbst wenn sie demokratische Rechte nicht im Ausmaß mancher westlicher Länder haben, so müssen sie dieses Manko über noch deutlich bessere Lebensbedingungen und größere Freiheiten in anderen Bereichen kompensieren. Dabei müssen sie auch stabil und sicher sein.
Eine attraktive, verkehrsgünstige Lage begünstigt die Entwicklung von Stadtstaaten. Idealerweise fehlen bedeutende natürliche Ressourcen, damit die Regierung gezwungen ist, auf Standortattraktivität, statt auf Ausbeutung von Ressourcen zu setzen. Gaza erfüllt diese Bedingungen nahezu perfekt: Es verfügt über potenziell gute Häfen mit kurzen Seewegen zu zahlreichen Handelspartnern, und es grenzt an das wirtschaftlich erfolgreichste und klar demokratischste und Land mit hoher Rechtsstaatlichkeit im Nahen Osten, nämlich an Israel. Eine gewisse kulturelle Vielfalt fördert zudem die wirtschaftliche und gesellschaftliche Dynamik, während eine zugleich vorhandene Homogenität das Zusammenleben erleichtert. Weshalb ist Gaza dennoch gescheitert?
Der Misserfolg von Gaza
Für den Erfolg von Stadtstaaten müssen drei weitere Bedingungen erfüllt sein: Erstens sollte die Regierung möglichst legitim sein. Entscheidend ist dabei nicht rechtliche oder internationale Legitimität oder gar international anerkannte Staatlichkeit. Vielmehr ist entscheidend, dass die Bevölkerung die bisherige Regierung grundsätzlich akzeptiert, ohne dass sie dazu mit Gewalt gezwungen wird. Anderenfalls lohnt es sich für die Regierung nicht, den Wohlstand der Bevölkerung zu fördern, weil diese dann noch stärker aufbegehren würde und schwieriger zu unterdrücken wäre. Zweitens darf die grenzüberschreitende Mobilität von den umliegenden Ländern nicht verhindert werden. Dafür darf drittens kein grundlegender Konflikt zwischen der Regierung des Stadtstaates und den umliegenden Ländern bestehen.
Alle drei Erfolgsbedingungen waren in Gaza verletzt: Nach dem Wahlsieg der radikal-islamischen Hamas im Januar 2006, einer brüchigen Einheitsregierung mit der Fatah und den Kämpfen um Gaza im Juni 2007 sind die Palästinensischen Autonomiegebiete faktisch zweigeteilt. Seither herrscht im Gazastreifen die Hamas in einem defacto Staat, auch wenn nach «Versöhnungsabkommen» formal eine Art Einheitsregierung entstand. Dieses Regime gilt weithin als illegitim – kaum jemand in Gaza oder anderswo hält es für gerecht oder wohlstandsfördernd. Die Hamas beutete die eigene Bevölkerung massiv aus und überzog die Nachbarn mit Terror. Grenzüberschreitende Mobilität war in Gaza wegen des Dauerkonflikts mit Israel nicht gegeben – und auch nicht mit Ägypten, das während des Gaza Krieges seine Grenzen genauso dicht geschlossen hielt wie Israel. Auch der Zugang zum Meer war blockiert. Die Bewegungsfreiheit der Einwohner Gazas blieb eingeschränkt, da sie vielerorts unerwünscht waren, was auch eine Folge der Illegitimität des Hamas-Regimes ist. Diese Abschottung erleichterte es der Hamas, die eigene Bevölkerung auszubeuten, und erschwerte zugleich, durch gute Politik neues, eigenes Steuersubstrat und Vertrauen zu gewinnen. Israels Sanktionen hatten vor allem einen Gewinner: die Hamas. Steigende Preise erhöhten den Wert der von ihr kontrollierten Produktion im Gazastreifen und befeuerten einen Schmuggel, den sie monopolartig kontrollierte und ausnutzte – die Mullahs und die Hisbollah unterstützten sie dabei. Unter solchen Bedingungen wirken selbst in Stadtstaaten die Anreize zu guter Politik zu schwach.
Was also tun?
Für eine erfolgreiche Entwicklung Gazas nach dem Modell von Stadtstaaten sind zwei Voraussetzungen notwendig und eine sehr hilfreich.
Erstens muss Gaza als Stadtstaat vollständig vom Rest der palästinensischen Autonomiegebiete unabhängig werden. Dies bedingt, das Konzept der Zweistaatenlösung zugunsten einer „wenigstens drei Staaten Lösung“ aufzugeben. Nur so kann sich Gaza losgelöst von den Streitigkeiten im Westjordanland entwickeln. Zweitens muss Israel die Mobilitätsbeschränkungen aufheben. Gelingt dies nicht, braucht Gaza zumindest freien Zugang zum offenen Meer und zum Luftverkehr. Die Lage entspräche dann jener einer Insel – und bekanntlich können auch kleine Inseln höchst erfolgreich sein. Hilfreich wäre drittens, Gaza in zwei oder mehrere voneinander unabhängige Stadtstaaten zu gliedern, ähnlich den Vereinigten Arabischen Emiraten. Der Wettbewerb zwischen ihnen würde die neuen Regierenden dazu drängen, ihren Bürgern gute Leistungen zu bieten, statt sich als «alleinige Vertreter Palästinas» zu inszenieren. Genau der Wettbewerb zwischen mehreren Stadtstaaten in Gaza würde auch die Hamas faktisch politisch entmachten oder sie dazu zwingen, gute Leistungen für die Bürger zu erbringen und für Frieden einzustehen.
Offen bleibt, wie demokratisch die Regierungen dieser Gaza-Stadtstaaten sein könnten. Der Clou des Stadtstaaten-Konzepts ist, dass es auch ohne voll ausgebaute Demokratie tragfähig wäre, weil institutionelle Anreize die Regierenden zu konstruktiver wirtschaftlicher Entwicklung drängen. Denkbar wäre zudem, dass die Stadtstaaten Partner- oder Patenstaaten finden, die sie beim Aufbau ihrer Institutionen und öffentlichen Leistungen mit Rat und finanzieller Unterstützung begleiten.
Nachhaltiger Frieden entsteht nicht durch Vermittlung allein, sondern durch tragfähige Institutionen vor Ort. Die Vermittlung der US-Regierung hat einen brüchigen Waffenstillstand gebracht. Jetzt gilt es, die Gelegenheit zu nutzen – um aus dem fragilen Waffenstillstand eine stabile Ordnung zu formen, die den Bürgern in Gaza echte Zukunftsaussichten bietet.
Auch Israel sollte diesen Weg nicht behindern. Jede positive Entwicklung käme auch seinen Bürgern zugute und würde die Lösung der Probleme im Westjordanland befruchten und vereinfachen. Mehr noch: Israel könnte die Entwicklung der Gaza-Stadtstaaten aktiv fördern, etwa indem es eine eigene Mittelmeerstadt zum freien Stadtstaat erklärt oder – besonders vielversprechend – einem der Gaza-Stadtstaaten eine Kooperation für einen grenzüberschreitenden, unabhängigen palästinensisch-israelischen Stadtstaat auf dem Gebiet des bisherigen Gazastreifens und Israels anbietet.
- Gaza als Stadtstaat
Ein Ausweg aus der Sackgasse? - 13. November 2025 - Putins Machtlogik und der Reformbedarf im Westen - 10. Mai 2025
- Die Macht der Kostenwahrheit
Warum Deutschland den Alleingang wagen sollte - 1. Dezember 2023