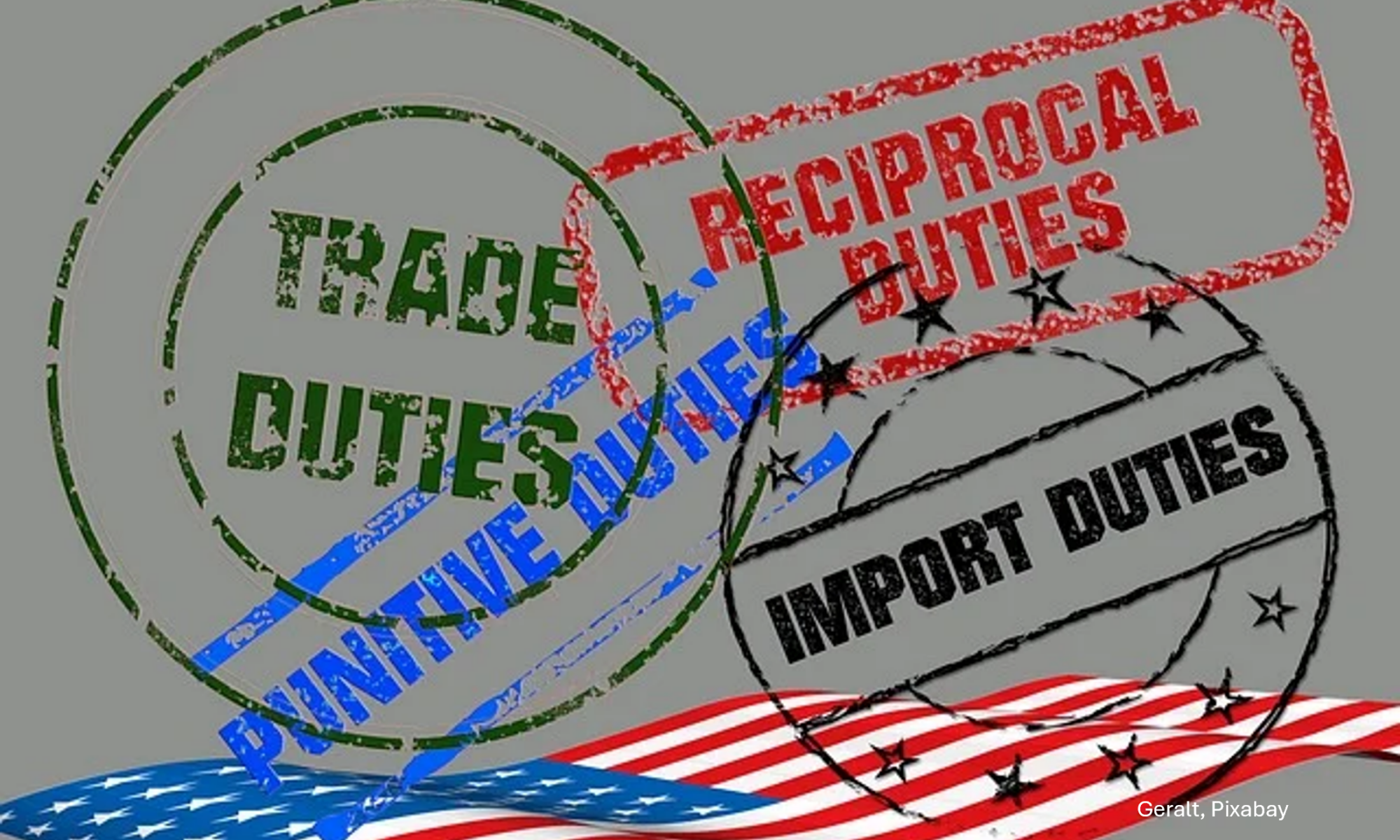Der amerikanische (Zoll)Schock
Donald Trump, die EU (und die Schweiz)
Donald Trump schlägt handelspolitische Schlachten von gestern. Er kann sie nicht gewinnen, wir aber können verlieren. Die Chancen sind gering, ihn zur zollpolitischen Umkehr zu bewegen. Europa tut gut daran, nicht auf Vergeltung zu setzen. Es muss die Lasten aus dem Zollschock tragen. Hilflos ist Europa dennoch nicht. Die Lasten lassen sich leichter tragen, wenn es die eigene Fähigkeit stärkt, sich an Schocks anzupassen. Eine nachhaltige Angebotspolitik, die konsequent die ökonomischen Rahmenbedingungen verbessert, ist die richtige Antwort im sinnlosen Handelskrieg. Dann hat der Zollvandalismus von Donald Trump vielleicht doch noch etwas Gutes. Er zwingt uns, etwas für unsere wirtschaftspolitische Fitness zu tun. Das ist längst überfällig.