„Staaten haben keine Freunde, nur Interessen.“ (Charles de Gaulle)
„Die Welt ist flach.“ Das ist der Titel des Bestsellers von Thomas L. Friedman. Er verfasste ihn im Jahr 2005. Die („ökonomische“) Welt erlebte gerade eine Blüte. Neue Transport-, Informations- und Kommunikationstechnologien öffneten die Märkte weltweit. Das Wettrennen zwischen politischen (tarifären und nicht-tarifären) und technologischen Transaktionskosten schien ein für alle Mal zu Gunsten der Technologie entschieden. Nichts schien die Globalisierung mehr aufhalten zu können. Für einige war das Ende der Geschichte nahe (Francis Fukuyama). Das hat sich geändert. Die handelspolitische Zeitenwende ist reaktionär. Merkantilisten, wie Donald Trump, versuchen, die Zeit zurückzudrehen. (Tarifäre) Handelshemmnisse sind das Mittel ihrer Wahl. Es spricht allerdings nichts dafür, dass sich dieses Mal die Macht gegen das ökonomische Gesetz (Eugen v. Böhm-Bawerk) durchsetzt. Auch wenn die Donald Trumps dieser Welt nur Pyrrhussiege erringen (hier), können die Kosten der handelspolitischen Disruption für alle Beteiligten erheblich sein.
Der amerikanische (Zoll)Schock
Mit der Präsidentschaft von Donald Trump begann eine zollpolitische Achterbahnfahrt. Zölle wurden angekündigt, eingeführt, ausgesetzt, wieder in Kraft gesetzt, ermäßigt, erhöht. Am „liberation day“ setzte Donald Trump das undurchsichtige Konzept der „reziproken“ Zölle in Kraft. Die Länder wurden mit unterschiedlichen Zöllen belegt. Das Hauptkriterium sind die Handelsbilanz-Defizite der USA mit den Ländern. Aber auch politische Überlegungen, illegale Drogenimporte oder Zu- oder Abneigung spielten eine Rolle. Oft endete der Zollstreit mit einem „Deal“. Wie lange er hält, ist höchst ungewiss. Für alle Länder gilt ein Basiszoll von 10 %. Es gibt aber auch Länder, die höhere Zölle entrichten müssen, wie etwa die EU mit 15 % oder die Schweiz mit 39 %. Ungewöhnlich ist auch, dass die Zölle in erster Linie nach Ländern und nicht, wie bisher üblich, vor allem nach Sektoren abgestuft werden.
Allerdings: Bei den Zolltarifen gilt es zweierlei zu berücksichtigen (hier). Zum einen weichen die am 2. April 2025 angekündigten länderspezifischen Zollsätzen von den tatsächlichen vereinbarten ab. Zum anderen sind die vereinbarten durchschnittlichen nominellen Zollsätze meist nicht mit den effektiven, importgewichteten Zollsätzen identisch. Für die EU-Länder forderten die USA einen Zoll von 20 %. Im Deal der EU mit den USA waren es dann 15 %. Tatsächlich kann aber der effektive durchschnittliche Zollsatz für die EU-Länder darüber oder darunter liegen. Für Luxemburg liegt er etwa bei 37 %, für Irland bei 3,5 % und für Deutschland bei 14 %. Der Grund für diese Abweichungen liegt in den vielfältigen sektoralen Ausnahmen. Auch für die Schweiz liegen die Zölle nicht bei 39 %, sondern „nur“ bei 23 %. Das könnte sich aber ändern, wenn auch die Pharmaprodukte der Schweizer Konzerne dem höheren Zollsatz unterworfen würden.
Dass die durchschnittlichen effektiven Zollsätze unter den vereinbarten nominellen Zollsätzen liegen, ist nur ein schwacher Trost. Viel wichtiger ist, wie sie sich mit dem Trump’schen Zollvandalismus verändert haben. Und da ist die Empirie eindeutig: Überall sind die Sprünge nach oben erheblich. Für Deutschland und Frankreich etwa stieg der durchschnittliche Zollsatz von 1,9 % vor dem „liberation day“ auf nun 14 %. Andere Länder in der EU, wie etwa Polen, traf es noch härter. Die Zollsätze verzehnfachten sich fast, von 1,7 % auf 16 %. Schwerer getroffen wurde auch die Schweiz. Hier stieg der durchschnittliche effektive Zollsatz von 1,9 % auf 23 %. Das sind erhebliche Veränderungen, mit denen die in die USA exportierenden Unternehmen fertig werden müssen. Die Belastungen relativieren sich allerdings etwas, wenn man berücksichtigt, dass die USA nur 15 % des Welthandels ausmachen.
Anpassungslasten verringern: externe Anpassung
Wirtschaftliche Schocks sind das tägliche Geschäft von Unternehmen und Politik. Das gilt auch für den amerikanischen Zollschock. Zwei Reaktionen sind denkbar: Die Anpassungslasten verringern und die Anpassungskapazität der Volkswirtschaft erhöhen. Die Strategien, die Anpassungslasten zu verringern, sind vielfältig. Eine erste Möglichkeit besteht darin, darauf hinzuarbeiten, dass der Spuk bald vorbei ist. Die Welt kann darauf hoffen, dass der Oberste Gerichtshof in den USA den zollpolitischen Eskapaden ein Ende macht. Sicher ist das nicht. Das Ausland kann versuchen, mit politischem Lobbying in Kongress und Senat dem amerikanischen Präsidenten doch noch Einhalt zu gebieten. Ein Erfolg scheint mehr als zweifelhaft. Letztlich bleibt die Hoffnung, dass die (Kapital)Märkte dem kostenträchtigen zollpolitischen Vandalismus über kurz oder lang ein Ende bereiten. Das könnte aber dauern.
Eine zweite Möglichkeit sind weitere Verhandlungen über einen „günstigeren Deal“. Ein solcher Ausgang ist nicht sehr wahrscheinlich. Es scheint, dass Donald Trump seine Machtpositionen genüsslich ausnutzt. Die Länder der EU haben sich über Jahrzehnte in die sicherheitspolitische Abhängigkeit der USA begeben. Das fällt ihnen nun auch ökonomisch auf die Füße. Kleinere Länder, wie die Schweiz, können trotz eigener wirtschaftlicher Stärke wegen mangelnder Größe keine glaubwürdige Druckposition gegen die USA aufbauen. Aber selbst, wenn es gelänge, neue Deals abzuschließen, was sind sie wert? Die Halbwertzeiten der Zusagen von Donald Trump sind gering. Nach der Ankündigung der EU, gegen amerikanischen Softwarekonzern Google wegen wettbewerbswidrigem Verhalten Geldbußen zu verhängen, hat Donald Trump stante pede neue Zölle gegen die EU angekündigt.
In der Diskussion ist auch immer wieder, Vergeltung zu üben. Mit dieser Strategie hofft man, Donald Trump zu einem zollpolitischen Discount zu bewegen. China ist diesen Weg gegangen, die EU nicht. Ein Blick auf die durchschnittlichen Zollsätze zeigt, sehr erfolgreich war China nicht. Die US-Zollsätze gegen China liegen gegenwärtig bei 35 %, die gegen die EU bei 13 %. Es ist offensichtlich, dass Vergeltung bei kleineren Ländern, wie der Schweiz, keine vernünftige Strategie ist (David verliert gegen Goliath). Eine andere Denkschule hält grundsätzlich nichts von Vergeltung. Sie setzt darauf, die Füße stillzuhalten, aus zwei Gründen: Ökonomisch stellt sich ein Land besser, wenn es auf Zölle nicht mit Gegenzöllen reagiert. Allerdings muss die Politik dann den heftigeren strukturellen Wandel aushalten. Politisch würde eine Strategie der Vergeltung die EU zerreißen. Die Außenwirtschaftsinteressen der EU-Länder sind grundverschieden.
Eine andere Möglichkeit, den zollpolitischen Eskapaden des Donald Trump aus dem Weg zu gehen, besteht darin, den eigenen Außenhandel stärker zu diversifizieren. Die wirtschaftlichen Abhängigkeiten von den USA würden geringer, die zollpolitischen Anpassungslasten fielen niedriger aus. Unternehmen machen seit langem nichts anderes. Sie versuchen, ihre internationalen Lieferketten zu optimieren, nun halt unter den erschwerten Bedingungen zollpolitischer Unsicherheiten. Länder können ihnen diesen Weg mit Freihandelsabkommen erleichtern. Solche Abkommen stoßen allerdings an Grenzen. Die jahrzehntelangen Verhandlungen der EU mit Mercosur zeigen die Probleme. Unterschiedliche sektorale Interessen, moralische Ansprüche und klimapolitische Forderungen sind oft fast unüberwindliche Hindernisse. Ein schneller Weg, die zollpolitischen amerikanischen Anpassungslasten zu verringern, ist das nicht.
In kleineren Ländern, wie der Schweiz, wird auch die Möglichkeit diskutiert, Schutz vor Donald Trump bei der EU zu suchen. Von einem Beitritt versprechen sich die Protagonisten einen besseren Schutz vor handelspolitischer Willkür der USA. Das könnte eine Fehleinschätzung sein. Zum einen ist der Deal der EU mit den USA fragil. Die EU kann die Versprechen, wie milliardenschwere Investitionszusagen und Energielieferungen, die sie Donald Trump gegeben hat, nie und nimmer einhalten. Es ist also nur eine Frage der Zeit, wann Trump den Zolldeal aufkündigt. Zum anderen ist der europäische Binnenmarkt eine Fata Morgana. Die nicht-tarifären Handelshemmnisse sind in der EU nach wie vor hoch. Sie entsprechen Zöllen in Höhe von 45 % bei Gütern und über 100 % bei Dienstleistungen (IWF). Die Schweiz käme bei einem Beitritt vom amerikanischen Regen in die europäische Traufe.
Anpassungskapazitäten erhöhen: Interne Anpassung
Es dürfte den meisten Ländern schwerfallen, die amerikanischen Zollschocks „zurück zu schocken“. Ob es gelingt, die zollpolitischen Anpassungslasten zu verringern, ist eine Frage der relativen Machtposition. Donald Trump hat gegenwärtig eindeutig die besseren Karten, vor allem gegenüber der EU. Seine Trumpfkarte ist die Abhängigkeit der Europäer vom militärischen Schutzschirm der USA. Handelspolitische Vergeltung wäre unter diesen Bedingungen ein Schuss ins eigene Knie. Die bisherige Unfähigkeit der EU, neue Freihandelsabkommen zu schmieden, lässt auch für diesen Weg in der näheren Zukunft wenig Gutes erwarten. Der moralische Zeigefinger und klimapolitische Illusionen dominieren noch immer die Verhandlungsstrategie der Europäer. Die Schweiz sollte der Versuchung widerstehen zu versuchen, mit einem Beitritt zur EU die zollbedingten Anpassungslasten zu verringern. Das wäre ein Schuss in den Ofen.
Wenn die europäischen Versuche, die Zollschocks zu verringern, von Faktoren abhängen, die die EU-Länder (noch) nicht beeinflussen können, müssen sie versuchen, die unvermeidlichen Anpassungslasten möglichst effizient zu verarbeiten. Die wichtigste Stellschraube ist die Anpassungskapazität ihrer eigenen Volkswirtschaften. Die können sie selbst steuern. Adäquat auf Schocks reagieren Länder, wenn sie besser und/oder billiger werden. Das erfordert flexible relative Preise – Reallöhne und Lohnstrukturen. Daran mangelt es in Europa nach wie vor. Die relativen Preise sind (nach unten) zu rigide. Ein höheres Wachstum der (Arbeits)Produktivität könnte für einen Ausgleich sorgen. Aber auch das gelingt in der EU nur unzureichend. Die USA sind (viel) besser. Der Weg zu höherer Produktivität ist beschwerlich. Ohne verstärkte Investitionen in Humankapital, Realkapital und technisches Wissen geht es nicht. Und es braucht dynamische private Unternehmer. Die Abkürzung über staatliche Industriepolitik führt dagegen (meist) in die Irre.
Die Angebotspolitik kann noch an einer anderen Stellschraube drehen: Mobilere Produktionsfaktoren. Exogene Schocks verändern wirtschaftliche Strukturen. Sektoren schrumpfen, andere wachsen. Unternehmen gehen pleite, andere erleben eine Blüte. Regionen verarmen, andere prosperieren. Alte Fähigkeiten werden obsolet, neue sind gefragt. Die Politik muss diesen strukturellen Wandel zulassen. Er ist erfolgreich, wenn die Faktoren dahin gehen, wo sie den höchsten Ertrag abwerfen. Die wichtigsten Treiber sind private Unternehmen. Ein unternehmerfreundlicheres Klima ist unverzichtbar. Nur dann investieren Unternehmen in Real- und Humankapital und Forschung und Entwicklung. Das reicht aber nicht. Arbeit muss sektoral, regional und beruflich mobil sein. Daran hapert es. Die Politik kann Hilfestellung leisten, nicht durch Subventionen, sondern durch anreizkompatible Reformen des Sozialstaates, vor allem aber durch Investitionen in Bildung, Forschung und Entwicklung.
Der wichtigste Beitrag, den die Politik leisten kann, um die Anpassungskapazitäten zu erhöhen, sind offene Märkte, Güter- und Faktormärkte. Sie sorgen für flexiblere relative Preise, höheres Produktivitätswachstum und mobilere Produktionsfaktoren. Das ursprüngliche Konzept der EU ist schon richtig, wenn sie auf die 4 Grundfreiheiten setzt(e). Mario Draghi hat sie jüngst in einer Studie für die EU-Kommission noch einmal angemahnt (hier). Die Realität sieht leider anders aus. Der europäische Binnenmarkt ist alles andere als offen. Vor allem der zukunftsträchtige Markt für Dienstleistungen ist voller nicht-tarifärer Handelshemmnisse. Die beste Antwort auf den amerikanischen Zollschock ist die Wiederbelebung des europäischen Binnenmarktes: Freier Waren-, Personen-, Dienstleistungs- und Kapitalverkehr. Er macht die EU-Länder resilienter gegen exogene Schocks. Und er ist ein wichtiger Treiber der politischen Integration in Europa.
Noch ein Wort zur Schweiz: Sie ist vom 39%-Zoll geschockt. Große Chancen, die amerikanischen Zölle herunterzuhandeln, bestehen eher nicht. Im Gegensatz zur EU hat die Schweiz zwar höhere Anpassungslasten zu schultern, sie ist aber bei der Anpassungskapazität wesentlich besser aufgestellt. Die relativen Preise sind flexibler als in der EU, das Wachstum der Produktivität ist höher, Arbeit ist mobiler. Und die Schweiz hat den Vorteil, dass sie das Arbeitsangebot relativ flexibel an die Arbeitsnachfrage anpassen kann. Die Personenfreizügigkeit mit der EU ist ein Puffer, der sektoralen, regionalen und qualifikatorischen „mismatch“ auf den Arbeitsmärkten verringert. Der strukturelle Wandel kann in der Schweiz friktionsloser als anderswo ablaufen. Die Weichen sind also gestellt, auch mit dem Zollschock besser als die EU fertig zu werden. Es wird allerdings interessant sein, wie die Schweizer Bevölkerung mit der Personenfreizügigkeit umgeht, wenn es um die neuen Rahmenverträge mit der EU geht.
Menetekel für die Globalisierung?
Der Zollkrieg, den Donald Trump gerade vom Zaun bricht, mag manchen wegen seines (noch) geringen empirischen Gewichts wie ein Sturm im Wasserglas vorkommen. Tatsächlich werden aber Trumps Zölle auch als der sprichwörtliche Kanarienvogel im weltweiten handelspolitischen Bergwerk interpretiert. Er signalisiere mit seinem Verhalten, dass auf die Globalisierung schwere Zeiten zukommen. Die regelbasierte multilaterale Ordnung scheint immer mehr ins Abseits zu geraten. Diese Entwicklung setzte schon lange vor Trump ein. Nur: Er forciert sie. Diskretionäre unilaterale Deals gewinnen an Boden. Die Gefahr ist nicht von der Hand zu weisen, dass sie ansteckend wirken. Wirtschaftliche und politische Macht dominieren die weltweiten Handelsvereinbarungen wieder. Protektionistische Entwicklungen werden hoffähig, die wirtschaftlichen und politischen Erfolge weltweit offenerer Märkte erodieren. Alle verlieren, auch die tarifären Brandstifter. Besonders trifft es aber arme Länder und arme Menschen. Vor allem sie können sich weltweiten Protektionismus und Planwirtschaft nicht leisten.
Vielleicht ist aber die Sicht auf die Zukunft der Welthandelsordnung zu pessimistisch. Vielleicht lassen wir uns augenblicklich zu sehr von der trump’schen öffentlichen Inszenierung des Zollstreites beeindrucken. Vielleicht gelingt es Donald Trump nicht, den Welthandel auf neue Füße zu stellen. Vielleicht haben weltweit offene Märkte doch noch eine Zukunft. Es ist zumindest erstaunlich, dass mit Ausnahme von China kein Land auf die „reziproken“ Zölle mit Vergeltung geantwortet hat. Das „Hegemon-Modell“ des Welthandels dürfte zwar passé sein. Die USA wollen die Kosten als Hüter der globalen Ordnung nicht mehr tragen. Sie ziehen sich zurück. Gut! Aber die USA sind nicht die Welt. Mehr als 3/4 des Welthandels haben nichts mit den USA zu tun. Es ist denkbar, dass es zu einer weltweiten Regelung ohne die USA kommt (WTO – 1). Möglich ist aber auch, dass sich „Koalitionen von Willigen“ bilden. In diesem „Herden-Modell“ (Richard Baldwin) kann es geregelten Systemwettbewerb zwischen den „Herden“ geben. Die globale Wirtschaft wäre dann auch ohne ein globales regelbasiertes System von Regeln geprägt.
Zum Schluss noch eine Spekulation über das vermeintliche Ende der Globalisierung. Ob die Märkte weltweit offenbleiben, hängt letztlich davon ab, wer das Rennen zwischen Handelshemmnissen (Macht) und Technologie (ökonomisches Gesetz) gewinnt. Grundsätzlich gilt: Die (politische) Macht zieht auf längere Sicht immer den Kürzeren (Böhm-Bawerk). Warum sollte es bei Handelshemmnissen anders sein? Die Innovationen beim Transport (Container), der Kommunikation und der Information haben seit den 90er Jahren die politischen Eingriffe in den internationalen Handel überkompensiert. Das galt beim Handel mit (physischen) Gütern. Das dürfte noch stärker bei Dienstleistungen gelten. Und Dienstleistungen werden eine immer größere Rolle spielen (Strukturwandel). Die Gefahr geht weniger von Zöllen aus. Zollkriege à la Trump sind Handelskriege von gestern (Don Quijote). Die möglichen Probleme sind eher nicht-tarifäre Handelshemmnisse. Auch sie haben gegen das ökonomische Gesetz keine Chance, hoffentlich.
Fazit
Donald Trump führt einen Zollkrieg, den er nicht gewinnen kann. Mehr als ein Pyrrhussieg ist nicht drin. Dem amerikanischen Wohlstand erweist er einen Bärendienst. Nur: Er fügt auch den weltweiten Handelspartnern einen Schaden zu. Die Chancen sind gering, ihn zur zollpolitischen Umkehr zu bewegen. Europa tut gut daran, nicht auf Vergeltung zu setzen. Handelskriege lohnen sich nicht. Die EU muss sich mit den zollpolitischen Lasten der USA abfinden und versuchen, sie durch Diversifikation im internationalen Handel zu verringern. Hilflos ist Europa dennoch nicht. Die Lasten lassen sich leichter tragen, wenn es die eigene Anpassungskapazität stärkt. Eine nachhaltige Angebotspolitik, die konsequent die Rahmenbedingungen verbessert und verstärkt in Humankapital und F&E investiert, ist die richtige Antwort im sinnlosen Handelskrieg. Dann hätte der Zollvandalismus von Donald Trump vielleicht doch noch etwas Gutes: Er zwingt uns in Europa, etwas für unsere wirtschaftspolitische Fitness zu tun. Das ist längst überfällig.
Blog-Beiträge zum Thema:
Norbert Berthold (JMU, 2025): Donald Trump und die Europäische Union. Katalysator oder Spaltpilz?
Norbert Berthold (JMU, 2025): Der amerikanische Don Quijote. Zölle, Ölflecken, Interventionsspiralen
Norbert Berthold (JMU, 2021): Wirtschaftskrisen, Strukturwandel und Staatswirtschaft. Resiliente Volkswirtschaften werden besser mit Schocks fertig
Podcast zum Thema:
Prof. Dr. Norbert Berthold (JMU) im Gespräch mit Prof. Dr. Aymo Brunetti (Universität Bern)
- Wie gerecht ist das denn?
Einkommen, Demographie, Vermögen - 23. Januar 2026 - Vermögensungleichheit – Ein non-issue?
Empirie, Ursachen, Handlungsbedarf - 30. Dezember 2025 - Was nun, Europa?
US-Sicherheitsstrategie, Eurosklerose, Europäische Verteidigungsunion - 19. Dezember 2025

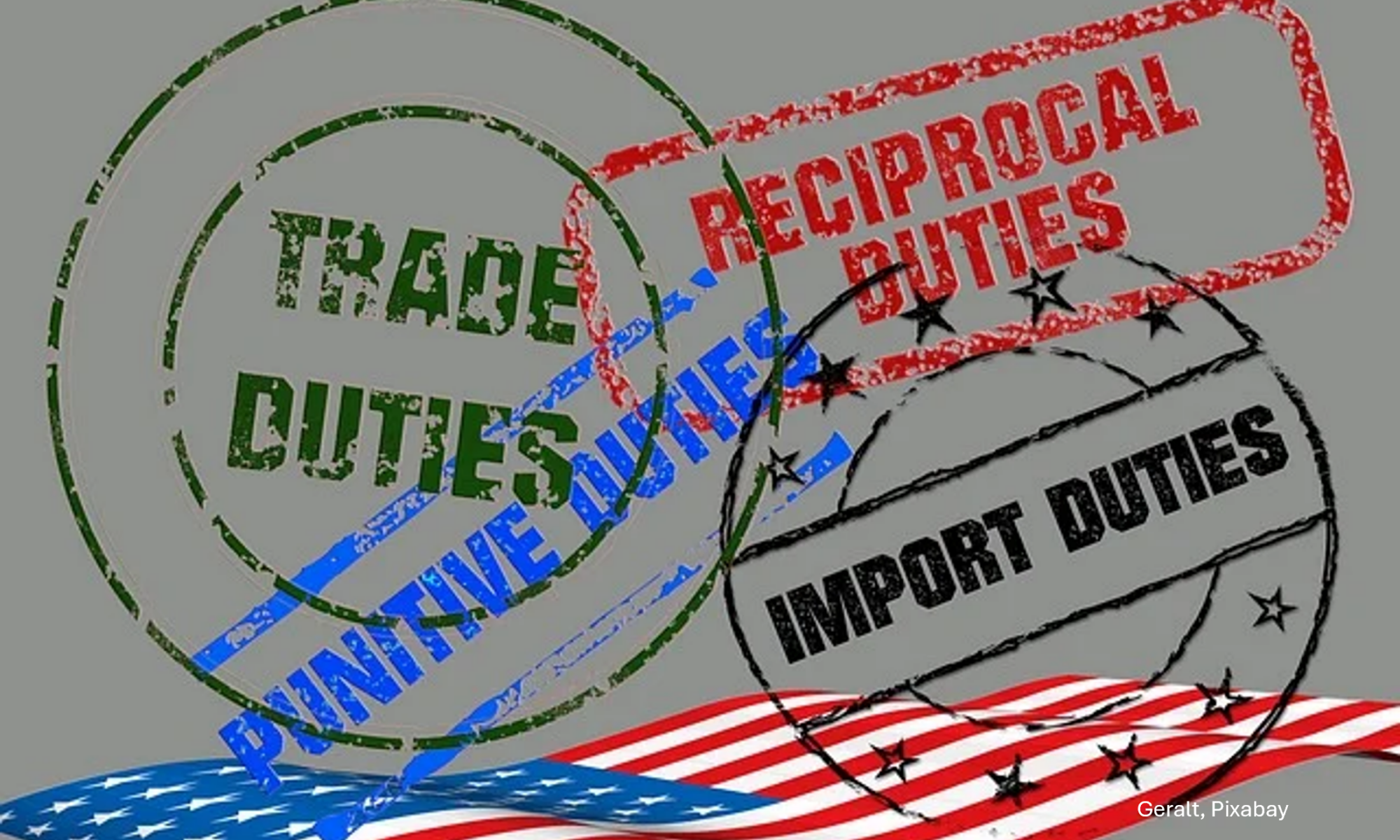
Ein brandaktuelles Interview mit der WTO-Chefin in diesem Kontext:
https://www.tagesschau.de/wirtschaft/weltwirtschaft/wto-okonjo-iweala-interview-100.html