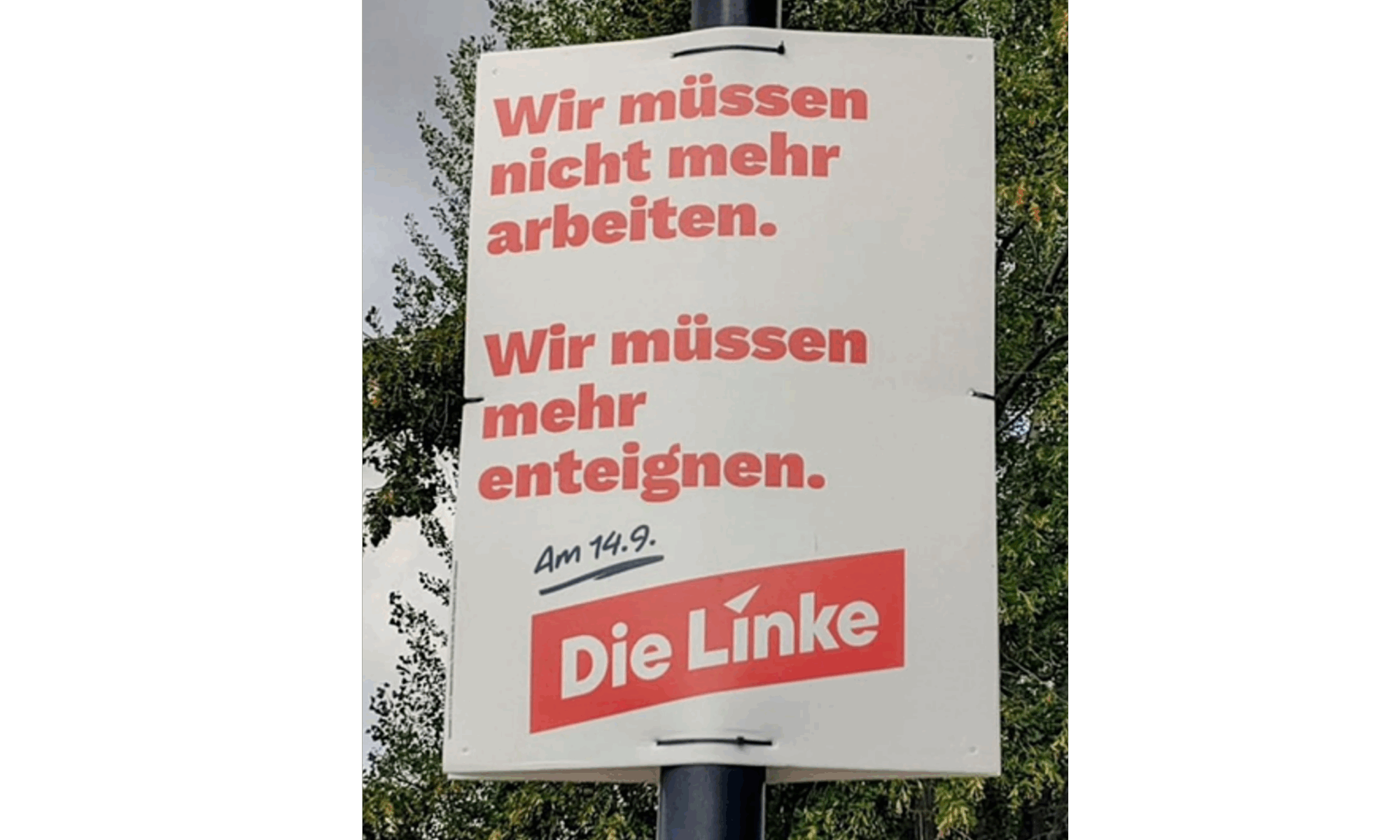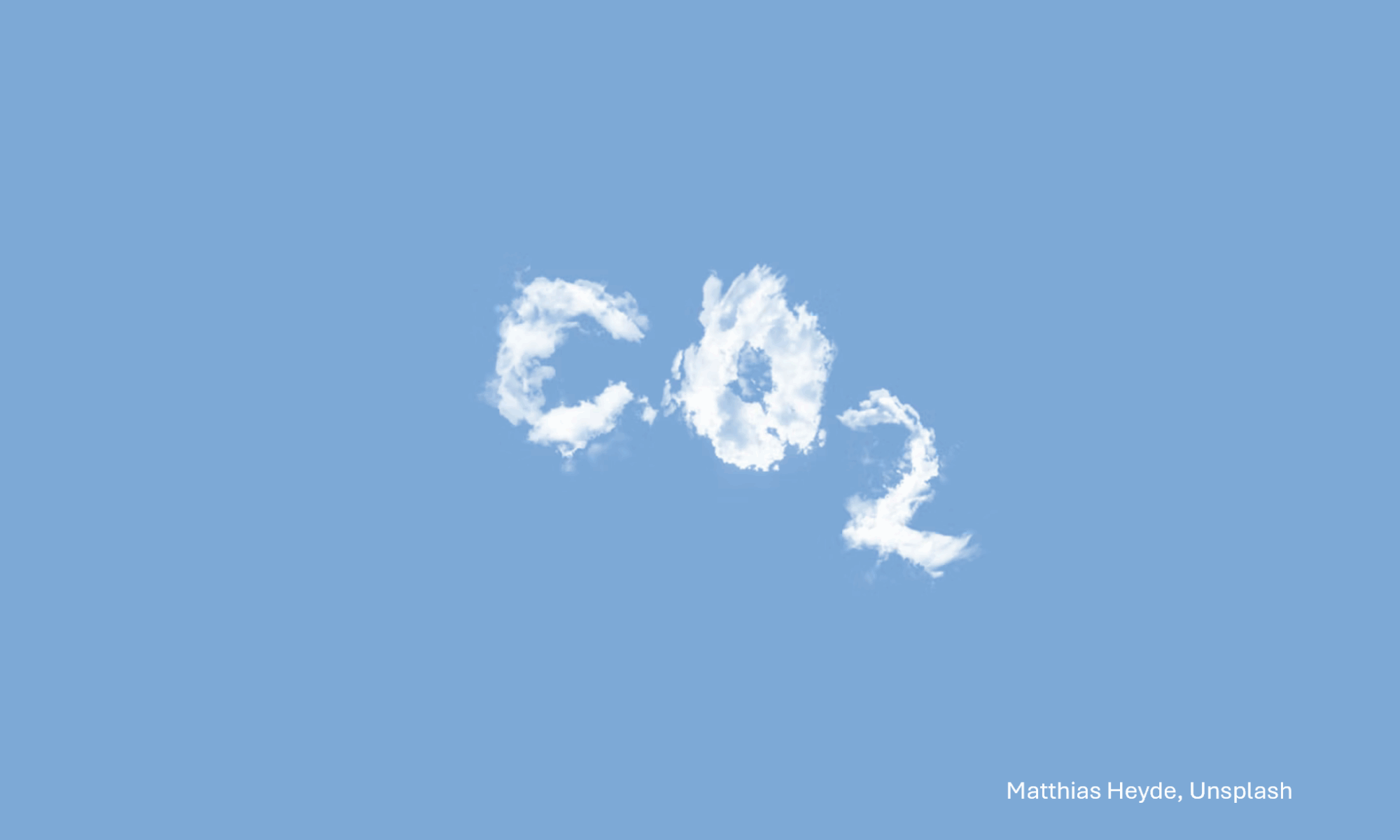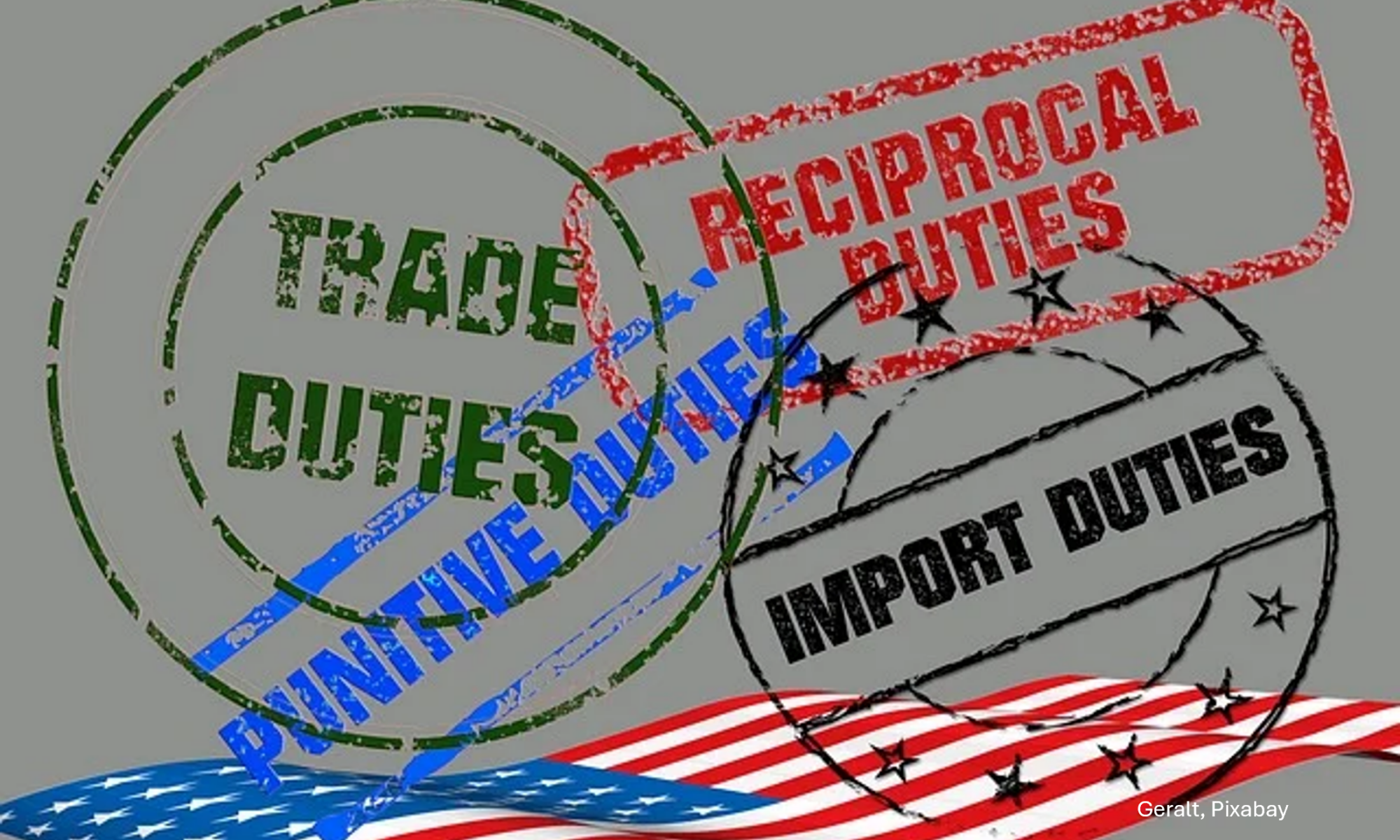Wie „gerecht“ ist das denn?
Einkommen, Demographie, Vermögen
Was gerecht ist, bleibt umstritten. Das ist bei Werturteilen die Regel. Philosophische Gerechtigkeitskonzepte verschleiern oft die (impliziten) Werturteile. Gesellschaften entscheiden im demokratischen Diskurs, was „gerecht“ ist. (Fast) alle wollen, dass Einkommen und Vermögen gleichmäßiger verteilt sind, einige mehr, andere weniger. Gesellschaften schlagen allerdings unterschiedliche Weg ein. Die einen setzen auf eine höhere soziale Mobilität (Chancengleichheit), andere stärker auf staatliche Umverteilung (Ergebnisgleichheit). Der erste Weg ist ökonomisch der effizientere. Trotzdem dominiert der zweite.