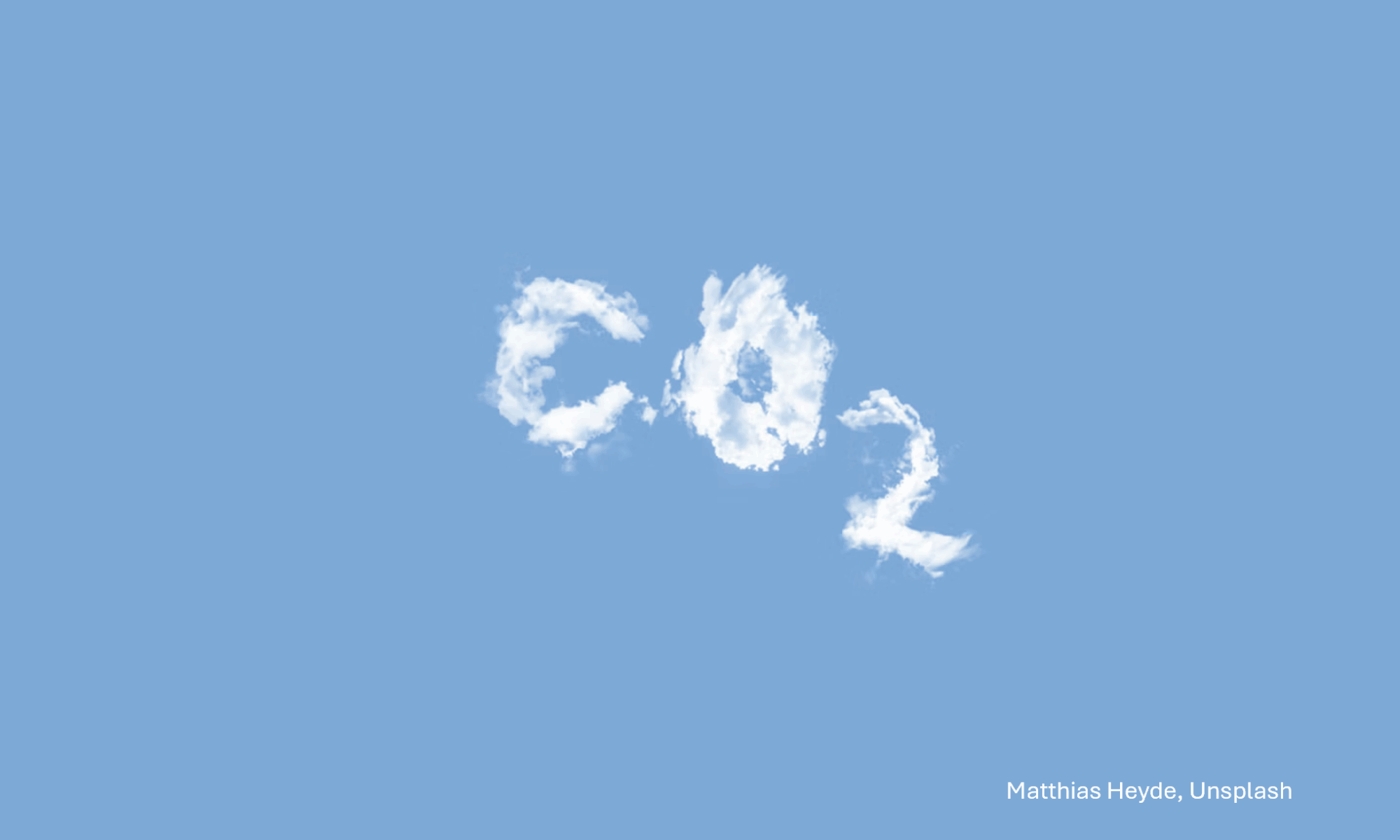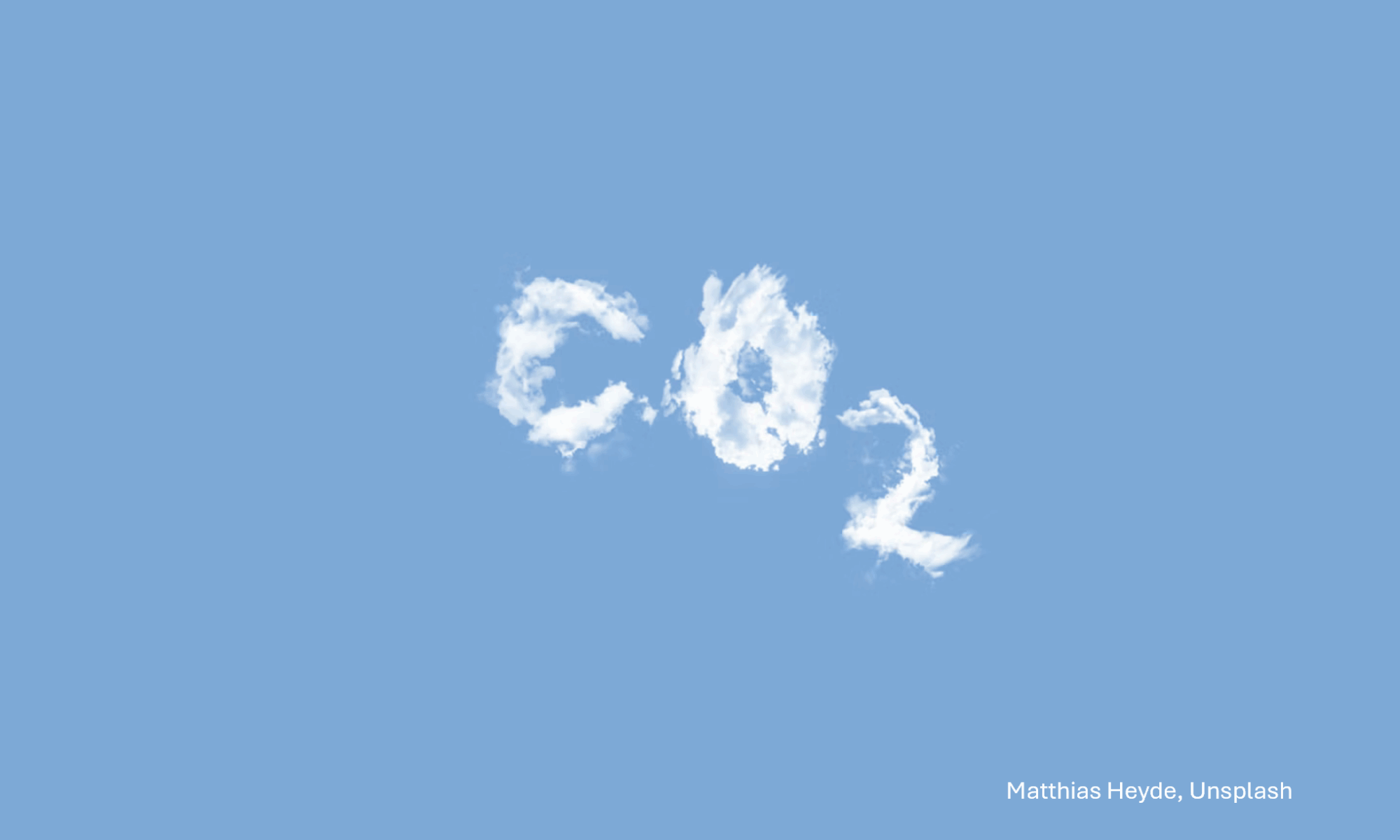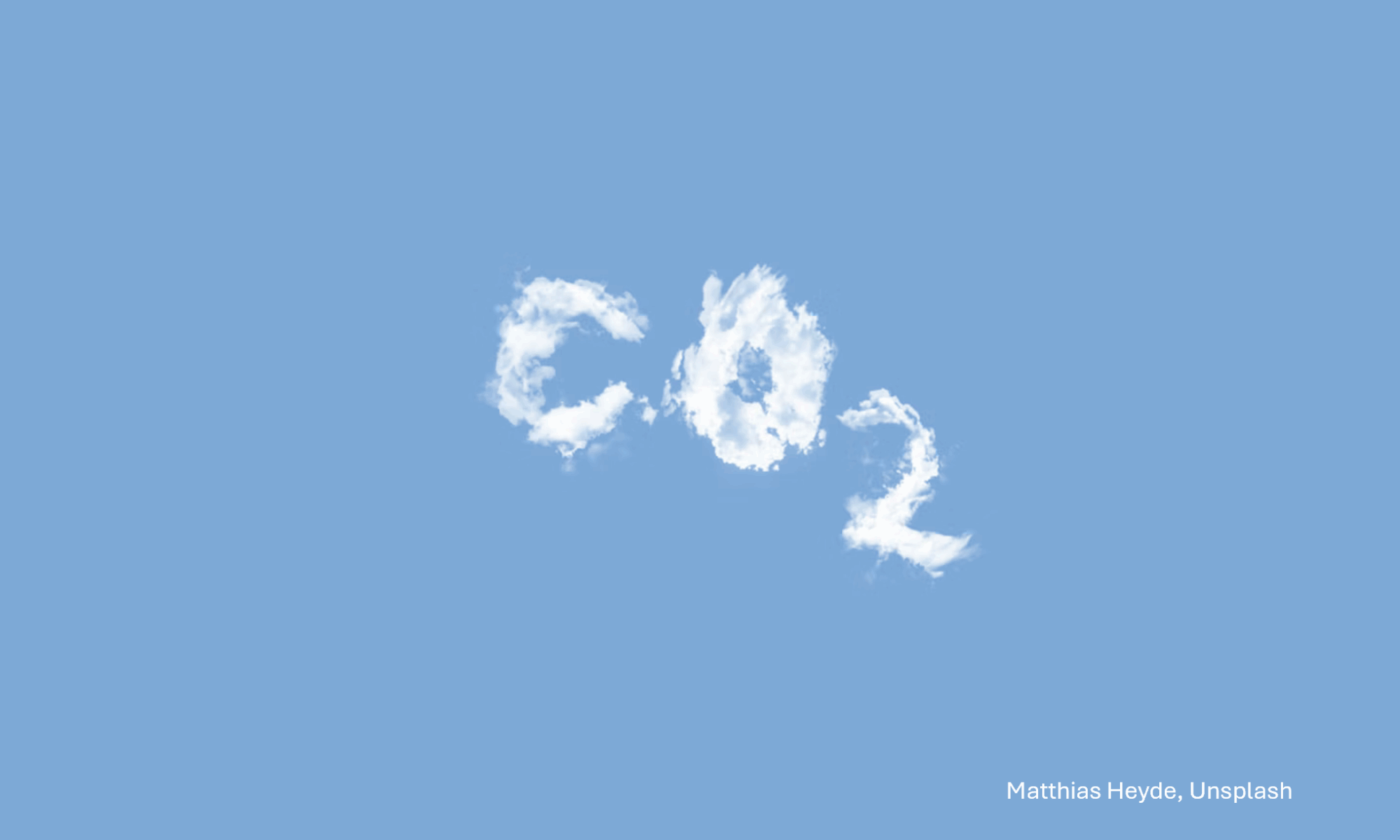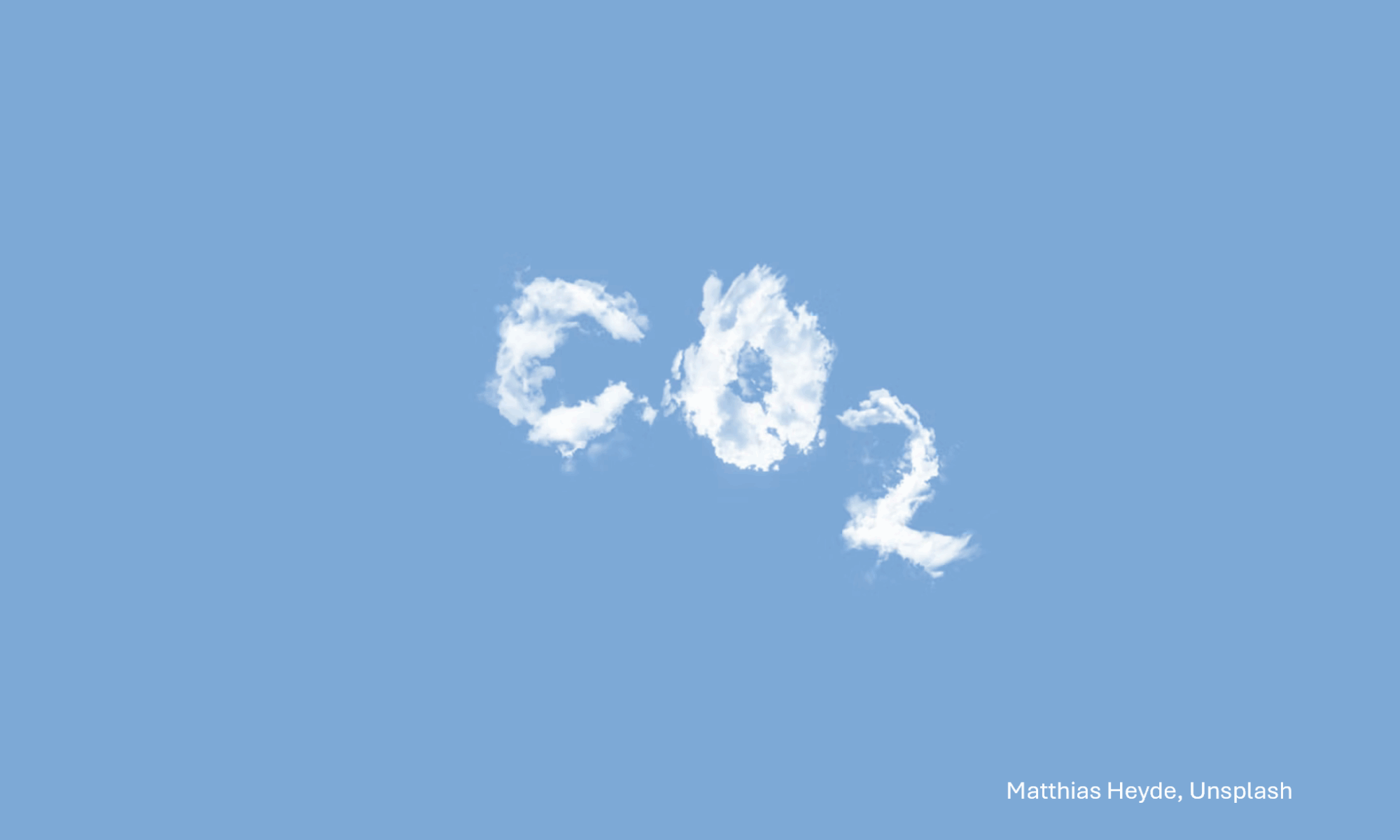Europäischer Emissionshandel in der Kritik (5)
Verschärfter C02-Preis
Die Bepreisung von CO2-Emissionen belastet die deutsche Wirtschaft. Wir geben einen Überblick über jüngste Entwicklungen bei den zwei EU-Emissionshandelssystemen (ETS 1 und 2) und dem Europäischen CO2-Grenzausgleichssystem (CBAM). Während der Grenzausgleich und die Verknappung der kostenlosen Zertifikate in der Industrie die deutsche Wirtschaft weiter belasten dürfte, ist Deutschland für den Emissionshandel im Verkehr und Gebäudesektor gut vorbereitet.