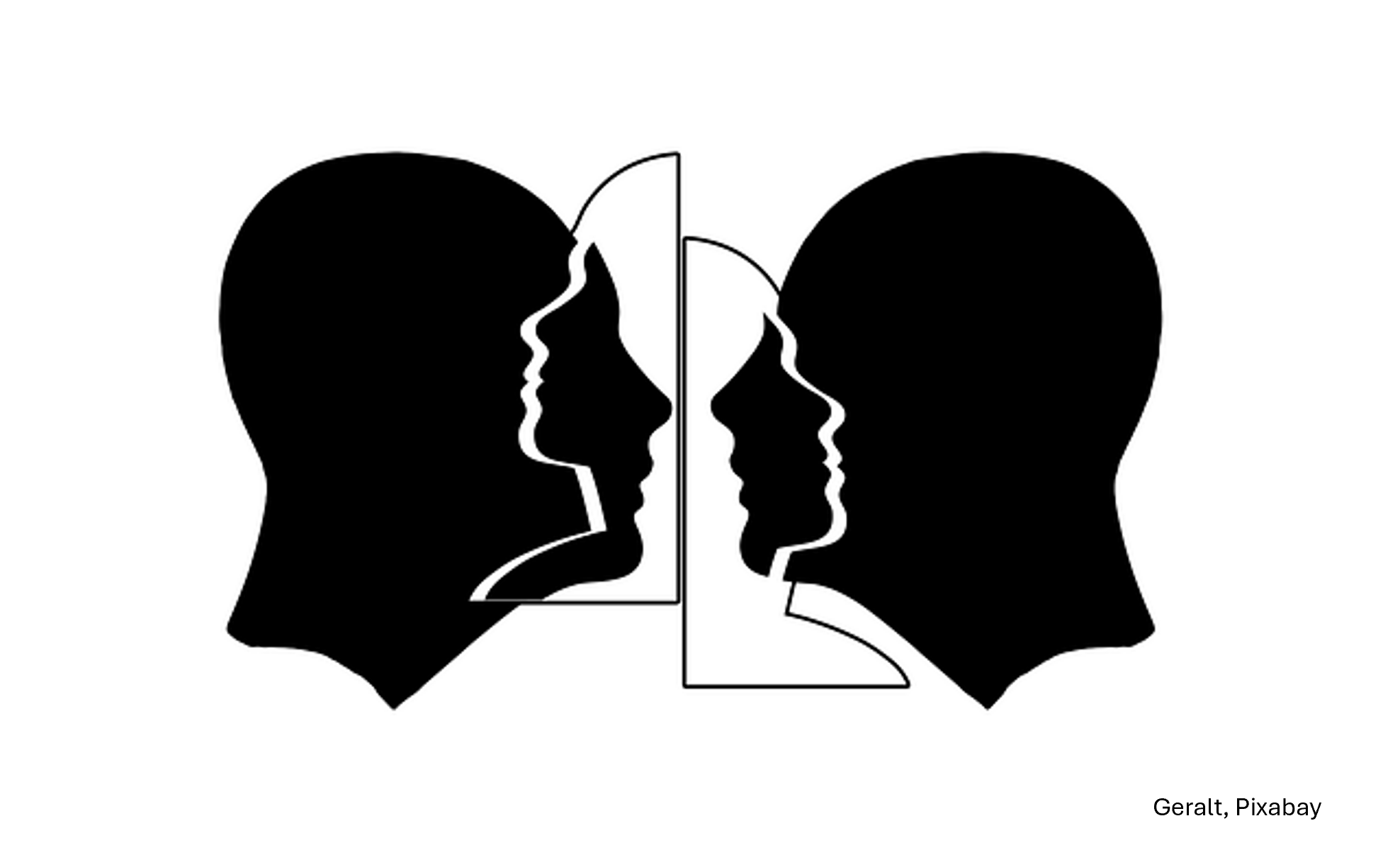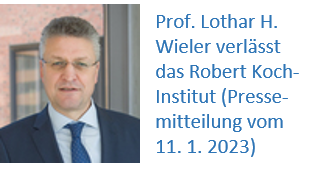Gastbeitrag
Ist der homo oeconomicus out?
Was von den Einwänden der „Caring Economics zu halten ist
Die „Caring-Ökonomen“ reklamieren die Entdeckung von Mitgefühl und Altruismus für sich, obwohl Grundlegendes darüber bereits vor über 250 Jahren bei Adam Smith in der Theorie der ethischen Gefühle abgehandelt worden ist. Ferner glauben sie, Adam Smith`s These, wonach wir unsere Nahrung nicht dem Wohlwollen sondern dem Eigeninteresse der Anbieter zu verdanken haben, widerlegt zu haben, obwohl am anonymen Markt Güter und Leistungen verkauft, statt verschenkt werden.