Die deutsche Wirtschaft sieht sich derzeit gleichermaßen mit internationalen Herausforderungen und hausgemachten Problemen konfrontiert. Unternehmen müssen mit den Folgen geopolitischer Konflikte, der US-Zollpolitik sowie insgesamt zunehmendem Protektionismus umgehen. Gleichzeitig belasten hohe Arbeits- und Energiekosten, der Fachkräftemangel sowie Steuer- und Bürokratielasten ihre Wettbewerbsfähigkeit.
Jahrzehntelang hat die Orientierung an Wettbewerbsfähigkeit, Effizienz und internationaler Arbeitsteilung die Produktivität vor allem in der deutschen Exportindustrie gesteigert und damit hohe Löhne auch in anderen Wirtschaftszweigen ermöglicht. Diese Globalisierungsdividende fällt künftig kleiner aus. Die Produktivität wächst seit einigen Jahren kaum noch. Die lange Zeit starke Wettbewerbsposition in der Hochtechnologie dürfte den Innovationsdruck geschmälert haben. So hat beispielsweise das FuE-Engagement in der Automobilbranche lange stagniert, erst seit 2020 lässt sich ein deutlicher Anstieg verzeichnen – auch wegen der zunehmenden Konkurrenz aus China. „China hat sich vom komplementären Handelspartner zum strategischen Rivalen entwickelt. Dabei profitieren chinesische Unternehmen von verzerrten Wettbewerbsbedingungen durch direkte Subventionen, eine unterbewertete Währung und weitere Handelsschutzinstrumente“, analysiert Lukas Bertram. Infolgedessen sehen sich deutsche Unternehmen zu Personalabbau und Verlagerung an günstigere Standorte gezwungen. Gleichzeitig wird das Klima für ausländische Unternehmen in China ungemütlicher: Investoren waren zwar lange willkommen, müssen sich aber zunehmend um Knowhow-Abzug und Marktzugang sorgen. Einige ziehen sich komplett zurück. Zunehmend zeigt sich jedoch, dass auch Chinas Möglichkeiten endlich sind. Hanna Hottenrott resümiert: „Chinas industriepolitisches Modell hat sich als teuer erwiesen, mit einem schlechten Preis-Leistungs-Verhältnis“.
Seit seinem WTO-Beitritt hat China die Vorteile des offenen Welthandelssystems genutzt, selbst aber vielfach die Regeln missachtet. Dies hat zur Erosion des Welthandelssystems beigetragen. Jürgen Matthes schlussfolgert daraus: „Die Zeitenwende zwingt uns dazu, Sand ins Getriebe der Globalisierung und der internationalen Geschäfte der deutschen Wirtschaft zu streuen.“ Ein wunder Punkt ist die Importabhängigkeit der deutschen Industrie von China, nicht nur bei Seltenen Erden. Dabei ist diese aufgrund der tiefen Verflechtung vielfach nicht einmal bekannt. Insgesamt ist die deutsche Exportwirtschaft aber breit aufgestellt und nicht zu stark von einzelnen Märkten abhängig. Das Exportwachstum im Handel mit Indien konnte beispielsweise die rückläufigen Lieferungen nach China seit 2019 fast ausgleichen. Eine weitere Diversifizierung ist allerdings nötig und auch möglich. Dazu sollte die EU Freihandelsabkommen mit Partnern in Lateinamerika und Asien vorantreiben.
Um angesichts der vielfältigen Herausforderungen wettbewerbsfähig zu bleiben, muss sich die deutsche Wirtschaft an die neuen Bedingungen anpassen. Dazu gehört auch, nicht zu lange an Geschäftsfeldern ohne langfristige Wettbewerbsperspektive festzuhalten und dadurch Arbeitskräfte und Kapital zu binden, die in aufstrebenden Unternehmen mittelfristig produktiver eingesetzt werden könnten. Der Fachkräftemangel in Kombination mit langen Bezugsmöglichkeiten von Kurzarbeitergeld dürfte das „Horten“ von Beschäftigten, die dann anderswo fehlen, verstärkt haben.
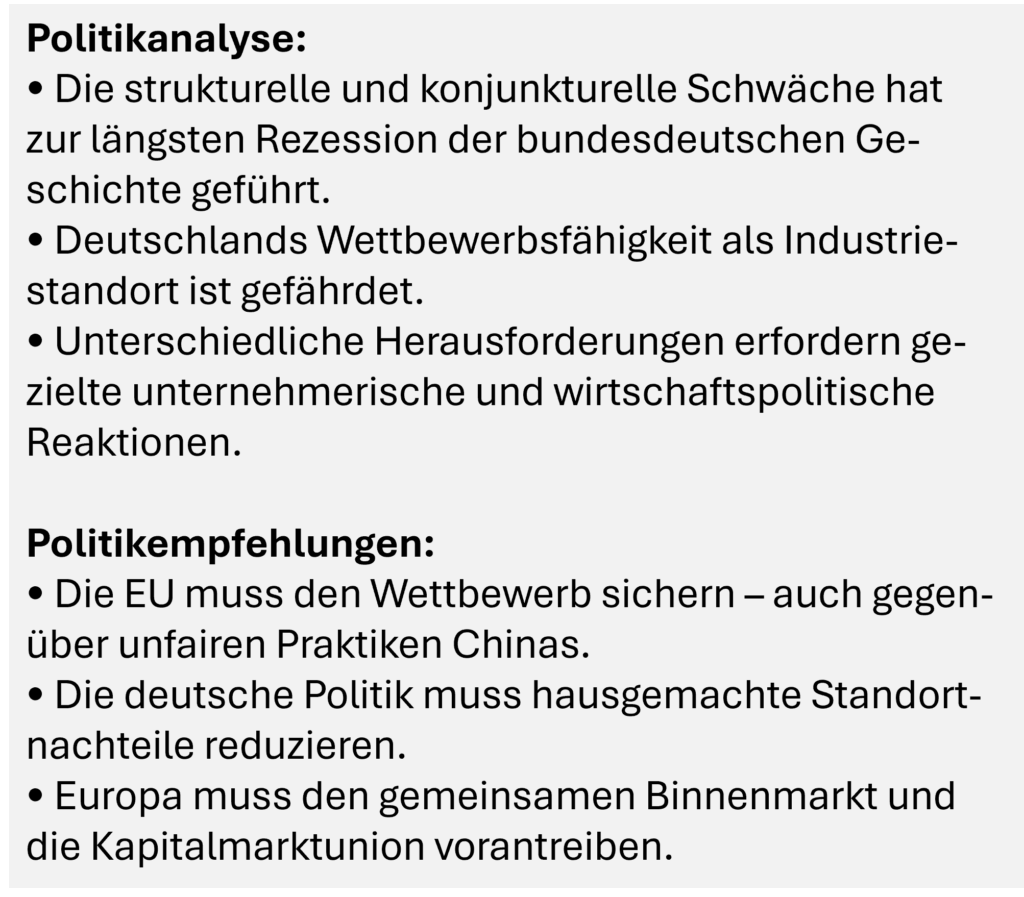
Zentrale Aufgabe der Politik ist es, investitions- und innovationsfreundliche Rahmenbedingungen zu schaffen, d. h. Wettbewerb, Produktivität und Resilienz zu stärken. Das erfordert in vielen Bereichen eine europäische Perspektive, beispielsweise in der Grundlagenforschung und der (kritischen) Infrastruktur. Bürokratische Hemmnisse und Binnenmarkthürden sollten zügig abgebaut werden, da sie den Wettbewerb einschränken und Markteintritte verhindern. Das bankenbasierte Finanzsystem erweist sich zwar als stabilisierend, begünstigt aber bestehende Strukturen gegenüber aufstrebenden, riskanteren Geschäftsmodellen, gerade Sprunginnovationen. „Viele gute und neue Ideen bekommen wir ohne Finanzierung nicht auf die Straße“, berichtet Unternehmerin Sarah Schniewindt, „die Vollendung der europäischen Kapitalmarktunion würde Produkt-, Prozess- und Geschäftsmodellinnovationen starken Auftrieb geben.“
Gegenüber einer auf die Rahmenbedingungen zielenden horizontalen Industriepolitik ist eine vertikale Industriepolitik, die selektiv Branchen oder sogar Unternehmen unterstützt, mit vielfältigen Herausforderungen verbunden. Zentral stellt sich die Frage, nach welchen Kriterien „zukunftsträchtige“ Geschäftsfelder identifiziert werden sollen. Will Politik „kritische Abhängigkeiten“ verhindern, lässt sich dies nicht allein an Importmengen festmachen, vielmehr müssten auch eine besondere Relevanz des entsprechenden Produkts und geringe Substitutionsmöglichkeiten vorliegen. Das Wissensproblem der Politik, Abgrenzungsfragen und die Lobby-Anfälligkeit interventionistischer Politik zeigen die Grenzen eines solchen Ansatzes.
Letztlich ist es Aufgabe der Unternehmen zu schauen, wo langfristig komparative Kostenvorteile oder Innovationsvorsprünge bestehen. Politik sollte den notwendigen Strukturwandel nicht bremsen, auch wenn er schmerzhaft ist und Partikularinteressen dagegenstehen.
Hinweis: Dieser Policy Brief entstand auf Grundlage des ECONWATCH-Panels „China-Schock 2.0, De-Globalisiung, Transformation: Ist das deutsche Industriemodell am Ende?“ im Rahmen der Jahrestagung 2025 des Vereins für Socialpolitik mit Lukas Bertram (ZOE Institut für zukunftsfähige Ökonomien), Prof. Dr. Hanna Hottenrott (TU München / ZEW), Jürgen Matthes (Institut der deutschen Wirtschaft Köln) und Dr. Sarah Schniewindt (Schniewindt GmbH & Co. KG, Neuenrade).
Blog-Beiträge zum Thema:
Norbert Berthold (JMU, 2023): Standortwettbewerb statt Industriepolitik. Schuldenfinanzierte Industriestrategie führt auf Abwege
Podcast zum Thema:
Renaissance der Industriepolitik. Keine gute Idee
An der Industriepolitik scheiden sich die Geister. Mario Draghi und die EU-Kommission sind der Meinung, Industriepolitik wäre ein Schlüssel für mehr Innovationen und ein höheres Produktivitätswachstum. Europa könnte endlich die Wachstumsschwäche überwinden. Robert Habeck und die alte Bundesregierung sind dagegen mit ihrer Industriepolitik gescheitert. Sie haben auf Verlierer gesetzt: Northvolt, Intel, Wolfsspeed. Wie Schwarz-Rot industriepolitisch agiert, ist noch ungewiss. Sie wollen den „Industriestandort Deutschland stärken“. Vieles läuft auf ein „weiter so“ hinaus.
Prof. (em.) Dr. Norbert Berthold (JMU) im Gespräch mit Prof. Reint Gropp PhD (IWH).

