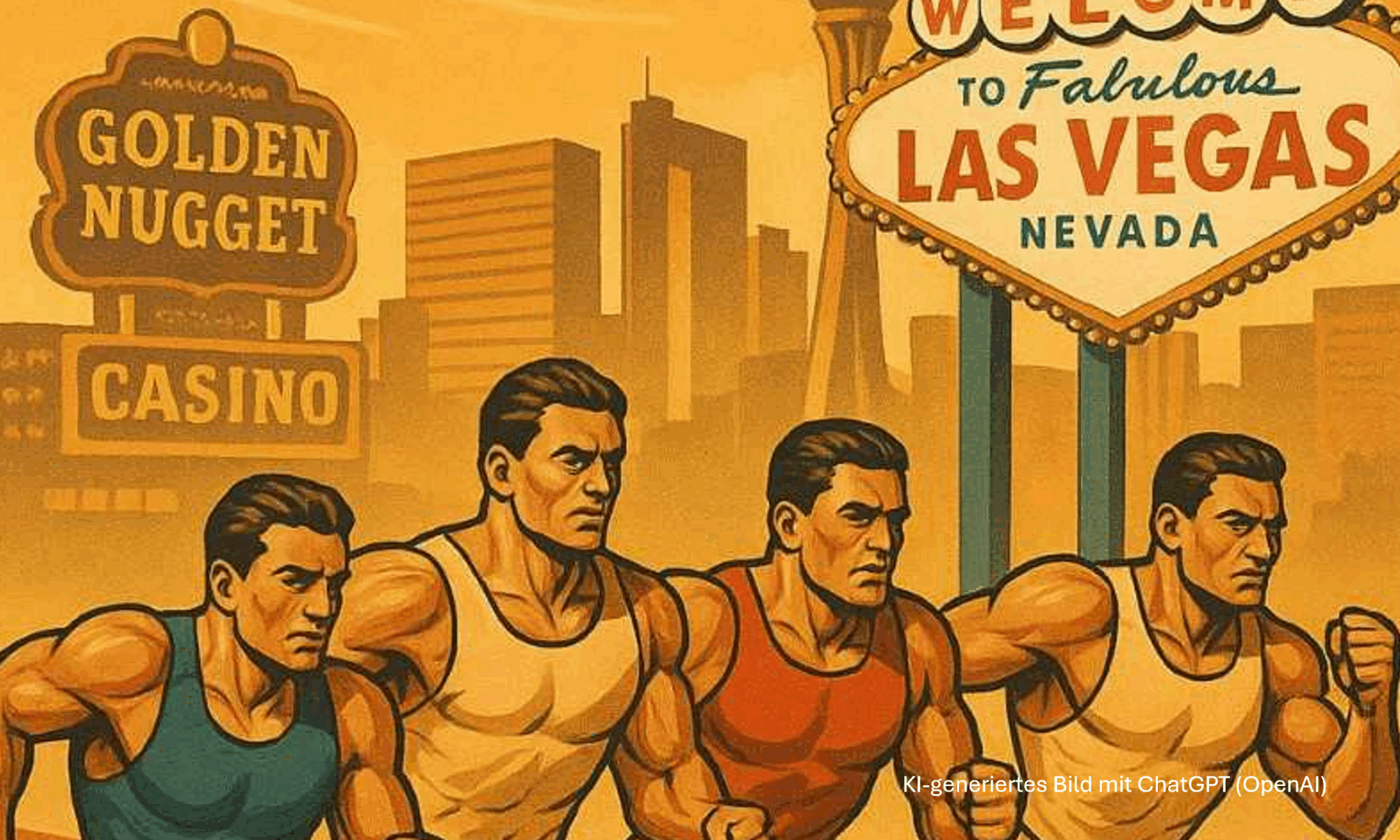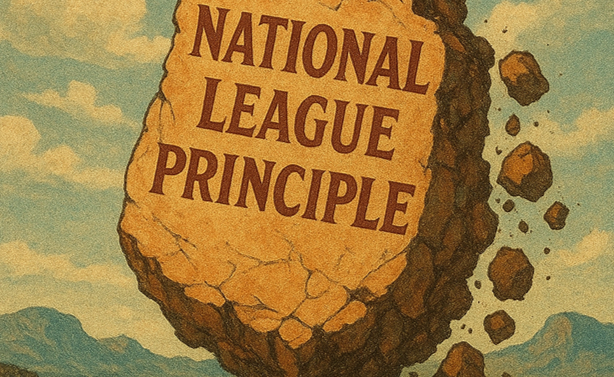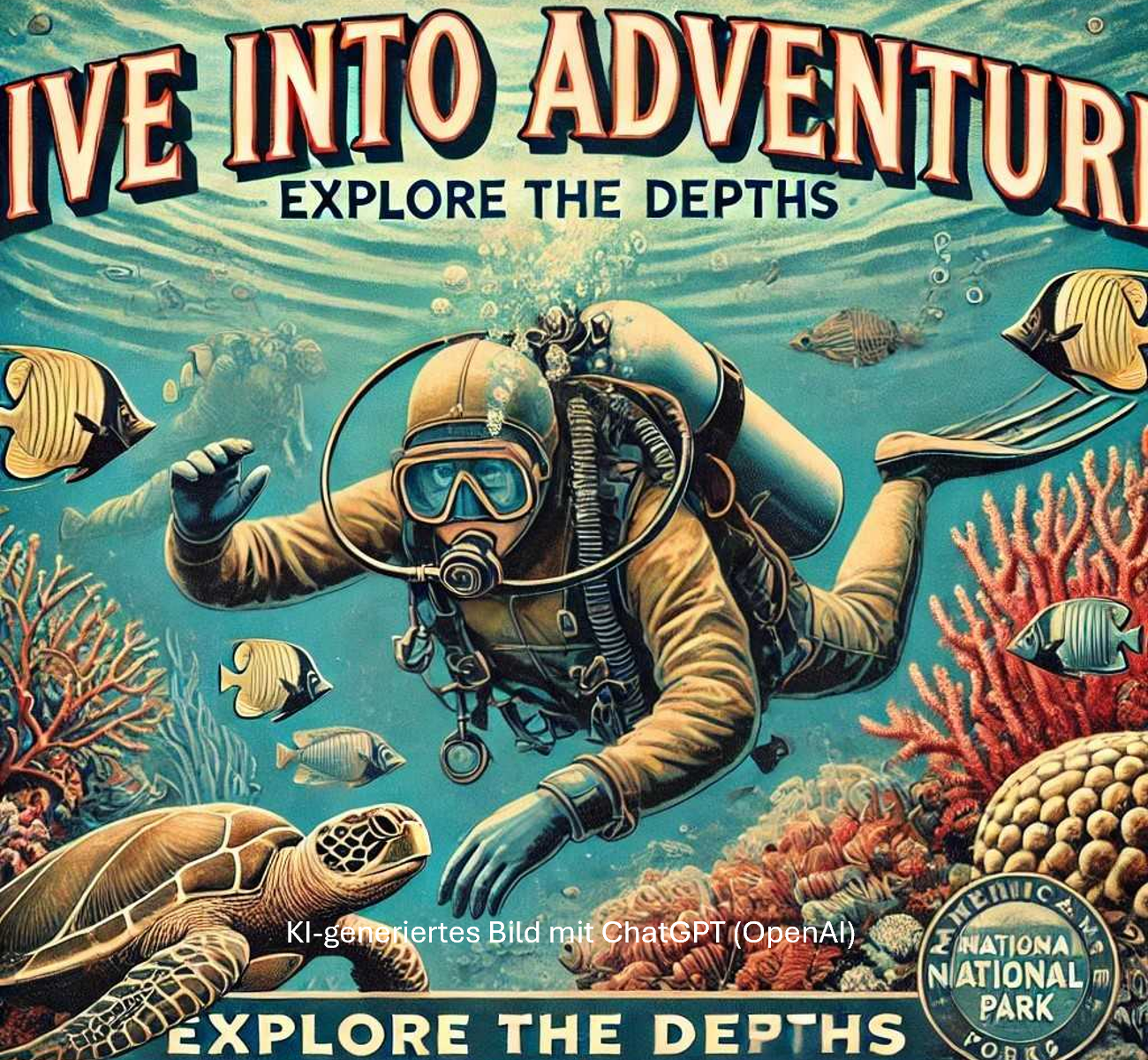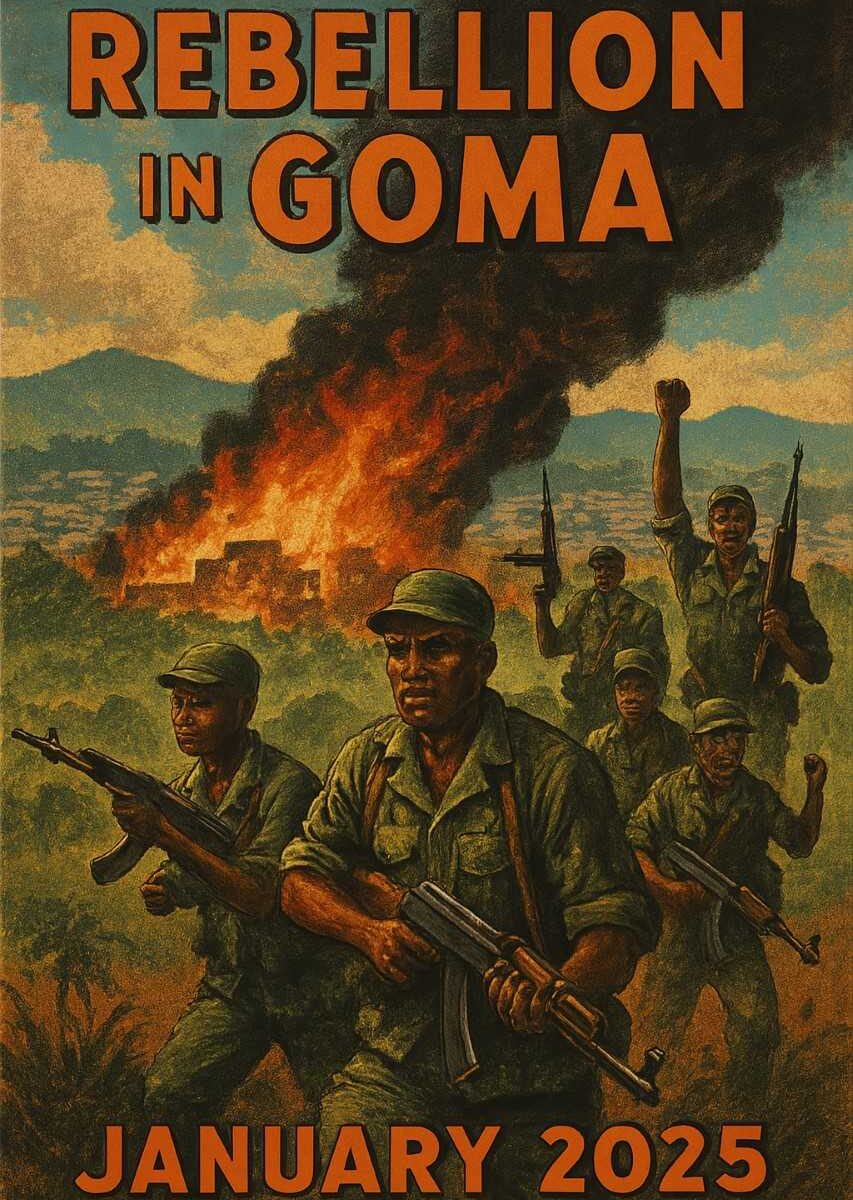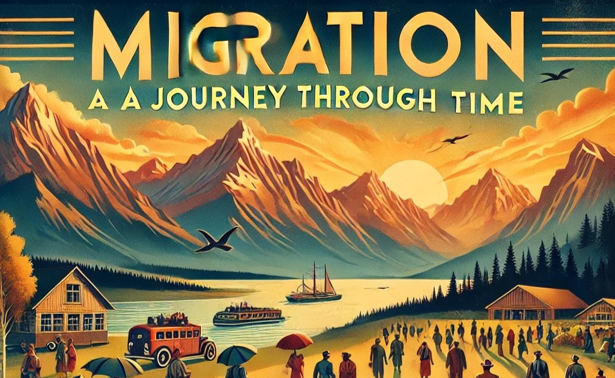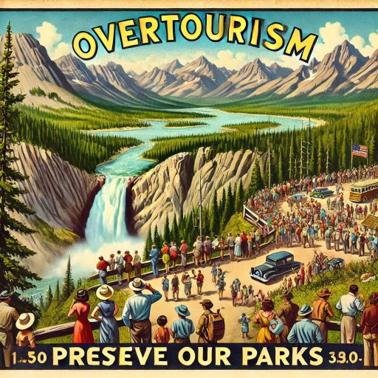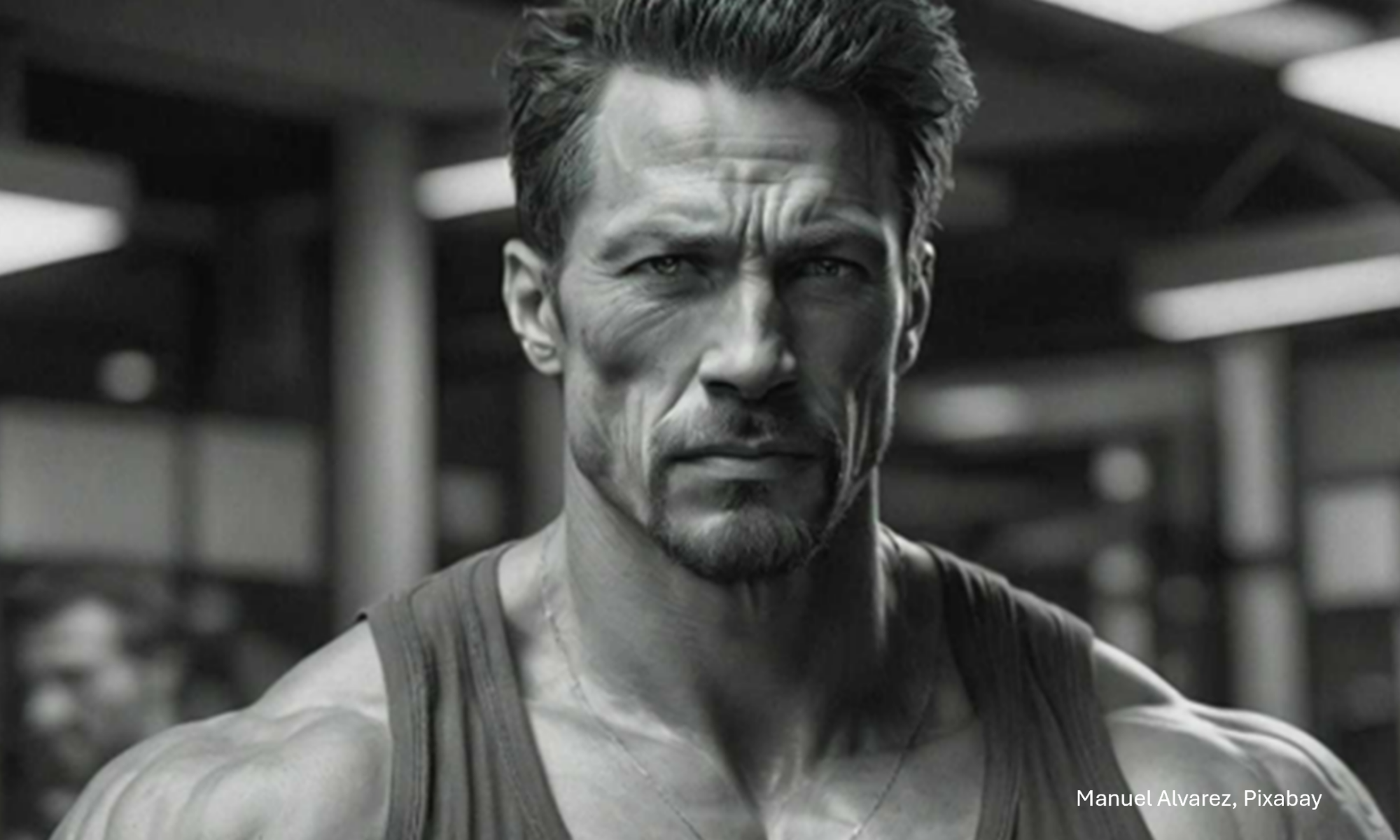„Controlled disruption“ für die deutschen Streitkräfte
Aufgrund der starren Strukturen scheint ein sinnvoller Weg zur Reform der deutschen Streitkräfte in einer „Controlled disruption“ zu bestehen, bei der um agile Einheiten herum eine neue Infrastruktur geschaffen wird und dysfunktionale Bereiche mittel- bis langfristig zurückgefahren werden.