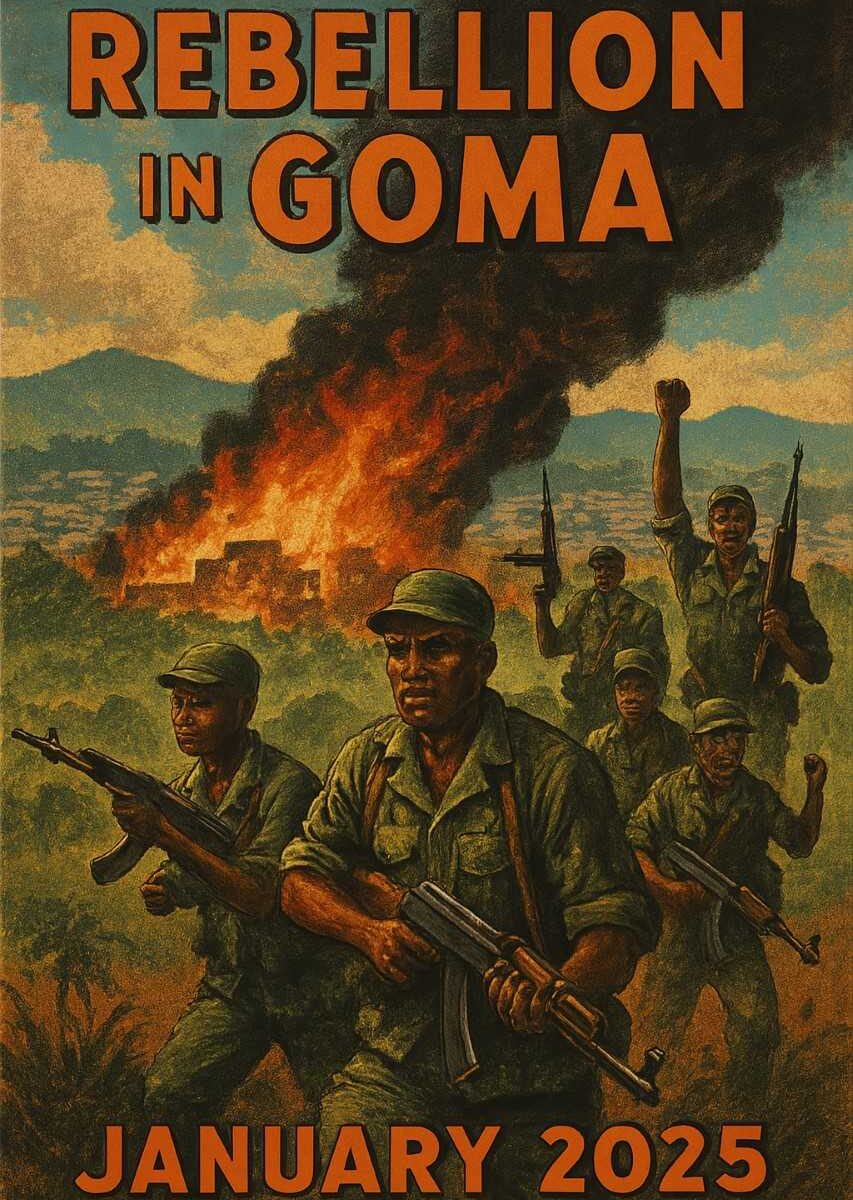In von Aufständischen okkupierten Gebieten zeigen sich erhebliche ökonomische Verwerfungen, die nicht nur die Versorgung mit Gütern des täglichen Bedarfs umfassen. Um einer humanitär äußerst bedrohlichen Situation mittelfristig entgegenzuwirken, muß es gelingen, die Wirtschaft zu revitalisieren.
Der Kongo hat eine lange Geschichte von Konflikten, politischen Unruhen und wirtschaftlichen Krisen, deren Ursachen bis in die belgische Kolonialzeit zurückreichen. Das Gebiet der heutigen Demokratischen Republik Kongo (DRK) gelangte im Zuge der Kongokonferenz im Jahre 1885 als Etat indépendant du Congo in das Eigentum der Association internationale du Congo, deren einziger Gesellschafter der belgische König Leopold II. war. Das rücksichtslose Vorgehen der Kolonialherren gegen die ortsansässige Bevölkerung (Kongogräuel), das insbesondere durch den Bericht von Roger Casement bekannt wurde, führte zu erheblichen internationalen Protesten, in deren Folge Leopold II. 1908 gezwungen wurde, seine Privatkolonie an den belgischen Staat zu verkaufen. Auf diese Weise entstand die Kolonie Belgisch-Kongo (Congo Belge). Dieser Kolonie wurden nach dem 1. Weltkrieg die früheren Königreiche Ruanda und Urundi als Mandatsgebiet zugeschlagen, die vorher in Form der Indirect Rule seit 1897 zum Kolonialbesitz des Deutschen Reichs gehörten.
Da für den Bergbau, die Landwirtschaft und für Infrastrukturprojekte im Belgisch-Kongo Arbeitskräfte benötigt wurden, organisierte die belgische Kolonialverwaltung in den 1920er bis 1950er Jahren gezielt die Umsiedlung von Tutsi aus Ruanda in den östlichen Kongo, insbesondere in die Regionen Nord-Kivu und Süd-Kivu, die direkt an Ruanda grenzen. Durch die Umsiedlung dieser Bevölkerungsgruppen, die als „Banyarwanda“ bezeichnet wurden, sollten nicht nur zusätzliche Arbeitskräfte dem Kongo zugeführt, sondern zugleich die sozialen Spannungen in Ruanda abgebaut werden. Dieses große Umsiedlungsprojekt führte zu erheblichen Konflikten mit den einheimischen kongolesischen Gruppen, insbesondere mit den Hutu und anderen Volksgruppen wie den Hunde und Nande.
Vor diesem Hintergrund sind die regelmäßig im Osten des Kongos auftretenden bewaffneten Auseinandersetzungen zu interpretieren. Ein maßgeblicher Akteur der Auseinandersetzungen in dieser Region ist die M23 (Mouvement du 23 mars), eine Rebellengruppe, die der Aufstandsbewegung L’Alliance du fleuve Congo (AFC) eng verbunden ist und sich als Reaktion auf das als defizitär empfundene Friedensabkommen zwischen der Demokratischen Republik Kongo und der Rebellengruppe CNDP vom 23. März 2009 gebildet hat. Die M23 vertritt angeblich die Interessen der im Osten der DRK lebenden Tutsi-Bevölkerung und findet offenbar Unterstützung durch das angrenzende Ruanda.
Im Januar 2025 eskalierte der seit geraumer Zeit andauernde Konflikt zwischen der M23 und den regulären kongolesischen Streitkräften, die durch Private Military Companies (Agemira und Romanii care au activat in legiunea franceza) unterstützt wurden. Im Zuge einer Offensive gelang es der M23, am 26. Januar die Stadt Goma, die Hauptstadt der Provinz Nord-Kivu und ein wichtiges Handels- und Verwaltungszentrum im Osten der DRK mit etwa 2 Millionen Einwohnern, einzunehmen. Mittlerweile (April 2025) besetzt die M23 weite Teile der rohstoffreichen Provinzen Nord-Kivu und Süd-Kivu. Dieses militärische Vorgehen führte zu einer erheblichen Fluchtbewegung. So wird vermutet, daß es im gesamten Kongo gegenwärtig etwa 7,8 Mio. Binnenflüchtlinge gibt und in der Region Nord-Kivu, die maßgeblich durch die militärische Intervention von M23 betroffen ist, allein etwa 1 Mio.
Die erneute Eskalation im Januar 2025 und die Einnahme der Stadt Goma verdeutlichen nicht nur die tief verwurzelten Probleme des Landes, sondern erlauben auch eine Wesensschau der durch den Krieg ausgelösten ökonomischen Verwerfungen, die im nachfolgenden skizziert werden sollen. Diese Phänomenologie kann Ansatzpunkte für den Ausbau gesellschaftlicher Resilienz in Krisensituationen liefern.
Die Gefechte im Zusammenhang mit der Einnahme der Stadt Goma führten zu zahlreichen Todesopfern, unmittelbar zum Zusammenbruch der Versorgung mit Lebensmitteln, Energie und Wasser. Folge davon waren umfassende hygienische Probleme, zumal auch eine Bestattung der getöteten Personen nicht zeitnah erfolgte.
Obwohl es den Rebellen gelang, die maßgebliche Versorgungsindustrie wieder in Gang zu setzen, ergeben sich zahlreiche ökonomische Folgeprobleme, die eine Regenerierung der Wirtschaft und eine Beseitigung der Notlage verhindern:
- Finanzembargo und der Zusammenbruch des Bankensystems: Die Zentralregierung in Kinshasa und die internationale Staatengemeinschaft (UN, EU, USA) sanktionieren Banken, die mit M23 zusammenarbeiten. Da es sich bei den meisten Banken um landesweite Institute handelt, reagieren diese im Rebellengebiet mit einer Einstellung des Geschäftsbetriebs, um entsprechenden Sanktionen aus dem Weg zu gehen. Als Folge davon entsteht ein Bargeldmangel. Da bargeldlose Zahlungen davon ebenso betroffen sind und andere Zahlungssurrogate kaum zugänglich sind und zudem ein Großteil der Bevölkerung weder über ein Bankkonto noch über eine Kreditkarte verfügt, können Unternehmen und Privatpersonen nur sehr eingeschränkt finanzielle Transaktionen durchführen.
- Doppelte steuerliche Belastung: Da auch die Rebellen auf finanzielle Ressourcen angewiesen sind, besteuern sie die ortsansässigen Unternehmen und Privatpersonen. Gleichzeitig bleibt jedoch die Steuerpflicht gegenüber dem Zentralstaat erhalten, der sich vor allem bei landesweit operierenden Gesellschaften an deren Betriebsvermögen schadlos halten kann und der freilich auch kein Interesse daran hat, im Rebellengebiet operierende Unternehmen von den anfallenden Steuern freizustellen.
- Wirtschafts- und Handelsembargo: Der Zentralstaat und die internationale Staatengemeinschaft sanktionieren nicht nur Banken, die im Rebellengebiet ihrer Geschäftstätigkeit nachgehen, sondern sämtliche anderen Unternehmen müssen ebenfalls mit entsprechenden – u.a. strafrechtlichen – Sanktionen rechnen. Dies führt dazu, daß viele Unternehmen im Rebellengebiet – insbesondere diejenigen, die sich landesweit betätigen – ihren Betrieb vor Ort einstellen.
- Umfassende Freisetzung von Arbeitskräften: Die doppelte Besteuerung, die Sanktionierungen sowie die erheblich eingeschränkten Möglichkeiten, finanzielle Transaktionen durchzuführen, resultieren darin, daß viele Unternehmen ihre Arbeitskräfte freisetzen. Ähnliches passiert bei NGOs, die ebenfalls gezwungen sind, ihre Mitarbeiter auszustellen.
- Versorgung mit Lebensmitteln: Trotz der oben beschriebenen Verwerfungen gibt es mittlerweile wieder ein gutes Angebot an Lebensmitteln, die offenbar über Ruanda eingeführt werden. Da aber zum einen aufgrund der Arbeitsfreisetzung die Zahlungsfähigkeit breiter Bevölkerungsgruppen rapide zurückgeht und zum anderen finanzielle Transaktionen nur eingeschränkt durchgeführt werden können, entstehen für die Bevölkerung erhebliche Probleme, sich zu versorgen.
- Eingeschränkte Gesundheitsversorgung: Die oben beschriebenen Erscheinungen schränken die Möglichkeiten, Kranke und Verletzte zu versorgen, erheblich ein. Dringend notwendige medizinische Versorgungen etwa kriegsbedingter Verletzungen – sogar lebensbedrohlichen Ausmaßes – werden häufig nur gegen Vorauskasse durchgeführt. Da aufgrund des Arbeitsplatzverlustes und des Zusammenbruchs des Bankensystems viele Betroffene nicht in der Lage sind, dies zu leisten, resultieren aus der Leistungsvorenthaltung teilweise letale Konsequenzen.
- Anstieg von Kriminalität und Plünderungen: Der Verlust des Arbeitseinkommens und die eingeschränkten Möglichkeiten, finanzielle Transaktionen durchzuführen, setzen massive Anreize, sich die benötigten Güter und Dienstleistungen mit Gewalt zu beschaffen. Eine ausufernde Kriminalität und Plünderungen in großem Maßstab sind die Folge.
Vor diesem Hintergrund stellt sich aus ordnungsökonomischer Sicht die Frage, was die örtlichen Machthaber tun könnten, um diese Mißstände zu beseitigen.
Entscheidender Ansatzpunkt für die wirtschaftliche Misere sind die Belastungen der Unternehmen in Form der doppelten Besteuerung und die Bedrohung mit Sanktionen durch die Zentralregierung und die internationale Staatengemeinschaft.
Eine politische Lösung bestünde in der Option, Verhandlungen mit der Zentralregierung in Kinshasa zu führen, um diese Hürden aus dem Weg zu räumen. Hierfür gibt es entsprechende Pläne: So sind für den 9. April 2025 Verhandlungen zwischen M23 und der kongolesischen Regierung in Doha anberaumt.
Sollte es bei den Verhandlungen zu keiner befriedigenden Lösung kommen, könnten die Rebellen auf einen regionalbegrenzten ordnungsökonomischen Lösungsansatz setzen. Dieser könnte wie folgt aussehen:
- Stabilisierung des Finanzsystems: Zum einen müßte versucht werden, die Funktionsweise des Finanzsystems wiederherzustellen. Hierzu könnte ein lokales Finanzsystem etabliert oder es könnten alternative Zahlungsformen, wie regional gültige Währungsscheine oder Warengeldsysteme, eingeführt werden. Zudem könnte versucht werden, verstärkt mobile Zahlungsdienste oder digitale Zahlungsmethoden zu nutzen.
- Vertrauensbildung bei Unternehmen und Privatpersonen: Die örtlichen Machthaber müßten einen stabilen Rechtsrahmen für wirtschaftliche Aktivitäten schaffen, um Unternehmen und Banken Rechtssicherheit zu gewährleisten, und diesen auch wirksam durchsetzen. Damit verbunden wäre auch die Notwendigkeit, die Kriminalität effektiv zu bekämpfen.
- Neutralisierung des Wirtschafts- und Handelsembargos sowie der doppelten steuerlichen Belastung: Die Machthaber könnten mit entsprechenden Maßnahmen sicherstellen, daß im betroffenen Gebiet tätige Unternehmen nicht doppelt steuerlich belastet werden und diese keine Sanktionen der Zentralregierung oder der internationalen Staatengemeinschaft aufgrund des Unterlaufens des Wirtschafts- und Handelsembargos befürchten müssen. Dies erfordert zweierlei: Die lokalen Machthaber müßten den dort tätigen Unternehmen glaubhaft machen können, daß sie dauerhaft das Aufstandsgebiet kontrollieren werden. Zudem könnten die lokalen Machthaber gezielt Rahmenbedingungen schaffen, die es landesweit oder international tätigen Unternehmen ermöglichen, ihre Geschäfte im Aufstandsgebiet unbehelligt weiterzuführen oder gar aufzubauen – beispielsweise durch Scheinunternehmen, Tarnorganisationen oder undurchsichtige Eigentumsverhältnisse, die eine Nachverfolgung durch die Zentralregierung oder die internationale Staatengemeinschaft erheblich erschweren.
Gelingt es den lokalen Machthabern, für Unternehmen ein stabiles rechtliches Umfeld zu schaffen, sind wesentliche Ansätze für eine Revitalisierung der Wirtschaft mit entsprechenden Folgen für den Arbeitsmarkt gesetzt. Freilich wirken sich die Maßnahmen eher mittelfristig aus, so daß kurzfristig nach wie vor humanitäre Hilfe erforderlich ist.
Quellen
Behalal, Z. (2025), The war for Congo’s wealth: How organized crime fuels the M23 crisis in eastern DRC, Zugriff am 4. April 2025 unter: https://globalinitiative.net/analysis/m23-organized-crime-rwanda-congo-drc-goma-conflict/
Cinamula, P., & Kabumba, J (2025), Rwanda-backed M23 rebels tighten their grip on second major city in eastern Congo, AP News 18. Feb. 2025, Zugriff am 4. April 2025 unter: https://apnews.com/article/congo-rebels-rwanda-m23-bukavu-9082c196b1a05e2b0b8992af770227df.
Fluck, S. (2025), Gewalt in Kongo-Kinshasa. Warum der Konflikt mit der M23 im Ostkongo eskaliert, Zugriff am 5. April 2025 unter: https://www.srf.ch/news/international/gewalt-in-kongo-kinshasa-warum-der-konflikt-mit-der-m23-im-ostkongo-eskaliert.
Guerin, O. (2025a), Rebels leave families devastated in wake of DR Congo advance, BBC news 18. Februar 2025, Zugriff am 4. April 2025 unter: https://www.bbc.com/news/articles/c5y98jjwx4no.
Guerin, O. (2025b), ‚They killed all these young people‘ – BBC investigates alleged massacre in rebel-held Congolese city, BBC news 14. März 2025, Zugriff am 4. April 2025 unter: https://www.bbc.com/news/articles/cgj5gl25756o.
Maseko, N. (2025), ‚I risked drowning to flee conscription by Congolese rebels‘, BBC news 3. März 2025, Zugriff am 4. April 2025 unter: https://www.bbc.com/news/articles/c93k9476694o.
o. V. (2025a), Rwanda tightens its grip over eastern Congo. The Congolese government has lost control of the region, The Economist, 20. Feb. 2025, Zugriff am 4. April 2025 unter: https://www.economist.com/middle-east-and-africa/2025/02/20/rwanda-tightens-its-grip-over-eastern-congo.
o. V. (2025b), The fall of Goma heralds more bloodshed in eastern Congo, The Economist, 30. Jan. 2025, Zugriff am 4. April 2025 unter: https://www.economist.com/middle-east-and-africa/2025/01/30/the-fall-of-goma-heralds-more-bloodshed-in-eastern-congo.
o. V. (2025c), M23 rebels withdraw from strategic DRC town ahead of landmark Doha peace talks, Africanews 4.4.2025, Zugriff am 5. April 2025 unter: https://www.msn.com/en-xl/africa/top-stories/m23-rebels-withdraw-from-strategic-drc-town-ahead-of-landmark-doha-peace-talks/ar-AA1CiZdo.
Reuters (2025), Congo doubles salaries for beleaguered army amid rebel advance, Zugriff am 4. April 2025 unter: https://www.reuters.com/world/africa/congo-doubles-salaries-beleaguered-army-amid-rebel-advance-2025-03-28/.
Winter, J., & Ross, W. (2025), DR Congo offers $5m bounties for rebel leaders, BBC news 9. März 2025, Zugriff am 4. April 2025 unter: https://www.bbc.com/news/articles/clyzkv7yl43o.
Wrong, M. (2025), How Far Will Rwanda Go in Congo? Amid Western Inaction, Kigali Is Carving Up Its Neighbor and Reigniting a Regional War, Foreign Affairs vom 3. März 2025, Zugriff am 4. April 2025 unter: https://www.foreignaffairs.com/democratic-republic-congo/how-far-will-rwanda-go-congo
- „Controlled disruption“ für die deutschen Streitkräfte - 17. Dezember 2025
- Die Enhanced Games 2026
Diabolus ad portam? - 29. Oktober 2025 - Die UEFA und die weitere Erosion des National-League-Principles - 18. Oktober 2025