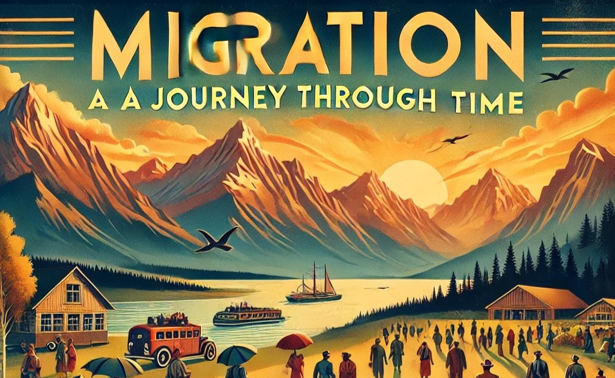Staaten bieten Leistungen an, die die Infrastruktur, die innere Sicherheit, Umverteilungsmaßnahmen und vieles mehr umfassen. Dafür erheben sie entsprechende Steuern. Im Sinne Tiebouts (1956) offerieren Staaten somit Leistungs-Steuer-Bündel, die sich zwischen den Staaten erheblich unterscheiden können. So existieren auf der einen Seite Staaten, die mannigfaltige Dienstleistungen ihren Bürgern offerieren, dafür aber hohe Steuern verlangen. Auf der anderen Seite gibt es Staaten, die ein Minimum staatlicher Leistungen anbieten, dafür aber sehr zurückhaltend bei der Besteuerung sind. Im eigentlichen Sinne verfügt jeder Staat über einen Kapitalstock, der das Faktorangebot und die Entlohnung der Einwohner maßgeblich beeinflußt.
Migration bedeutet in diesem Zusammenhang, daß Individuen ihren ursprünglichen Wohnsitzstaat – aus welchen Gründen auch immer – verlassen, um sich in einem anderen Staat niederzulassen. Migration kann somit zu einem Abfluß von Humankapital im Herkunftsland (Brain Drain) und zum anderen zu einer Belastung der Sozialsysteme im Zielland (Welfare Migration-Problem) führen.
Vor diesem Hintergrund könnte sich das Transfersystem, wie es im Fußball bis zum Bosman-Urteil im Jahre 1995 galt, als interessanter Lösungsansatz darstellen. Das Transfersystem mit Ablösesummen zeichnet sich dadurch aus, daß der Spieler nach Beendigung seines Arbeitsverhältnisses, das durch Ablauf, Kündigung oder Aufhebung vollzogen werden kann, auf eine Transferliste aufgenommen wird und somit für neue Vertragsvereinbarungen mit anderen Klubs zur Verfügung steht (Daumann 2023). Dabei ist vom übernehmenden Klub stets eine Ablösesumme zu zahlen, die zwischen dem aufnehmenden und dem abgebenden Klub frei vereinbart wird. Sofern keine Einigung zustande kommt, wird ein Schiedsgericht eingeschaltet, dessen Entscheidung bindend ist. Damit es zu einem Spielerwechsel kommt, müssen folgende Bedingungen erfüllt sein:
- Das zukünftige Wertgrenzprodukt des Spielers muß im neuen Klub größer ausfallen als im alten Klub. Nur dann kann der neue Klub die Ablösesummenforderung des abgebenden Klubs erfüllen.
- Der neue Klub muß dem Spieler mindestens ein Gehalt zahlen, das so hoch ist wie das Gehaltsangebot des alten Klubs.
Nur wenn beide Bedingungen erfüllt sind, kommt es zu einem Wechsel.
Obwohl eine derartige Regelung scheinbar den freien Faktorverkehr behindert, verteilen sich die Spieler auf die Teams, in denen die Spieler ihr höchstes Wertgrenzprodukt erzielen, da es sinnvoll für einen Klub ist, einen Spieler an einen anderen Klub abzugeben, bei dem er ein höheres Wertgrenzprodukt erzielt (Coase-Theorem). Das Transfersystem behindert insofern tatsächlich nicht eine effiziente Verteilung der Spieler-Talente in professionellen Sportligen (Invariance-These).
Diese Erkenntnis wollen wir für die Migration nutzen (Daumann & Klöcker 2024).
Grundsätzlich nimmt ein Individuum das Leistungs-Steuer-Bündel des Staates in Anspruch, in dem es lebt. Die Abwanderung des Individuums führt dazu, daß nun das Leistungs-Steuer-Bündel des Zuwanderungsstaates genutzt wird. Besonderes Merkmal des Transfersystems ist, daß mit einem derartigen Übertritt eine Kompensationszahlung des abgebenden oder auch des aufnehmenden Staates verbunden sein kann.
Dies soll im folgenden erläutert werden:
Für die Betrachtung muß der Staat, in dem das betreffende Individuum derzeit lebt (Herkunftsstaat), und der Staat, in den es einzuwandern beabsichtigt (Gaststaat), unterschieden werden. Aus Sicht eines der beiden Staaten ist ein Individuum ein Nettoempfänger, wenn der Barwert aller öffentlichen Leistungen, die dieses Individuum im betreffenden Staat zukünftig erhalten wird, größer ausfällt als der Barwert der Steuerzahlungen, die dieses Individuum im betreffenden Staat in Zukunft bezahlen wird. Nettozahler wäre das Individuum dann, wenn der Barwert der zukünftigen Steuerzahlungen den Barwert der vermutlich in Zukunft genutzten öffentlichen Leistungen übersteigt. Aufgrund unterschiedlicher Nutzen-Steuer-Bündel und einer unterschiedlichen Produktivität könnte dasselbe Individuum in einem der beiden Staaten Nettozahler und im anderen Nettoempfänger sein.
Die Anwendung des Transfersystems bedeutet nun, daß die Migration eines beliebigen Individuums, unabhängig welcher Art diese Migration ist (entweder Arbeitsmigration oder Wohlfahrtsmigration), mit einem Ausgleichsbeitrag entweder an den Herkunfts- oder an den Gaststaat verbunden ist (Daumann 2000). Welcher der beiden Staaten eine Ausgleichszahlung leistet, hängt vom erwarteten Beitrag des Individuums im betreffenden Staat ab. Bei einer Migration des Individuums aus dem Herkunftsstaat in den Gaststaat lassen sich die folgenden Fälle unterscheiden:
- Das Individuum ist im Herkunftsstaat Nettozahler. In diesem Fall verlangt der Herkunftsstaat eine Ausgleichszahlung in Höhe von mindestens der Differenz des Barwerts der zukünftigen Steuerzahlungen und des Barwerts der zukünftigen Nutzung öffentlicher Leistungen im Herkunftsstaat. Der Gaststaat wird – falls das Individuum auch dort Nettozahler ist – maximal eine Ausgleichszahlung in Höhe der Differenz des Barwerts der erwarteten Steuerzahlungen und des Barwerts der erwarteten Nutzung öffentlicher Leistungen im Gaststaat anbieten. Falls das Individuum im Gaststaat Nettoempfänger ist, wird der Gaststaat mindestens eine Ausgleichszahlung in Höhe der Differenz zwischen dem Barwert zukünftig empfangener öffentlicher Leistungen und dem zukünftiger Steuerzahlungen im Gaststaat erwarten. Eine Migration kann somit nur dann stattfinden, wenn die Differenz des Barwerts der zukünftigen Steuerzahlungen und des Barwerts der zukünftigen Nutzung öffentlicher Leistungen im Gaststaat höher ausfällt als im Herkunftsstaat. Mit anderen Worten: Für einen Nettozahler im Herkunftsstaat, der Nettoempfänger im Gaststaat ist, werden sich die beiden Staaten nicht einigen können; dieses Individuum kann demzufolge nicht auswandern.
- Das Individuum ist im Herkunftsstaat Nettoempfänger. In diesem Fall würde sich der Herkunftsstaat bereit erklären, eine maximale Ausgleichszahlung in Höhe der Differenz des Barwerts zukünftig empfangener öffentlicher Leistungen und dem zukünftiger Steuerzahlungen im Herkunftsstaat anzubieten. Ist das Individuum im Gaststaat Nettozahler, wird der Gaststaat maximal eine Ausgleichszahlung in Höhe der Differenz des Barwerts der erwarteten Steuerzahlungen und des Barwerts der erwarteten Nutzung öffentlicher Leistungen im Gaststaat in Aussicht stellen. Die Migration kann stattfinden. Ist das Individuum im Gaststaat Nettoempfänger, wird der Gaststaat mindestens eine Ausgleichszahlung in Höhe der Differenz zwischen dem Barwert zukünftig empfangener öffentlicher Leistungen und dem zukünftiger Steuerzahlungen im Gaststaat verlangen. In diesem Fall kann eine Migration nur dann stattfinden, wenn die Differenz des Barwerts zukünftig empfangener öffentlicher Leistungen und dem zukünftiger Steuerzahlungen im Herkunftsstaat höher ausfällt als im Gaststaat.
Wenn weder der Herkunfts- noch der Gaststaat bereit sind, eine Kompensation zu zahlen, kann eine Migration nur dann erfolgen, wenn ein Dritter die Kompensationszahlung übernimmt. Hier könnten NGOs, private Geldgeber oder aber die Kirchen die Kompensationszahlung übernehmen.
Was wären die Folgen dieses Konzepts:
Ein derartiges Konzept würde zum einen dazu führen, daß die auswanderungswilligen Personen am Ende dort ankommen, wo ihr Beitrag für die jeweilige Gesellschaft am größten ist. Es wäre bspw. für einen Heimatstaat irrational eine größere Austrittsprämie dem Individuum mitzugeben als den Barwert der Differenz aus Beiträgen und Leistungsinanspruchnahme im Heimatland.
Zum anderen würde dieses Konzept dazu führen, daß ein stärkerer Wettbewerb zwischen den Staaten entstünde, was sich positiv auf die Ausgestaltung der jeweiligen Institutionen – ausgehend von der Infrastruktur bis zur sozialen Abdeckung – auswirken würde. Die Staaten hätten vor diesem Hintergrund ein großes Interesse daran, ihre Institutionen effizient zu gestalten (Daumann 1995). Damit verbunden wäre vermutlich auch ein Abbau sozialer Unterstützungen. Aufgrund der teilweise erheblichen Translokationskosten würde sich aber auch nicht zwangsläufig ein Race to the bottom einstellen (Woolcock 1994, 39 ff.; Sinn, H. W. 1997).
Eine weitere wichtige Folge wäre, daß das Asylsystem, wie es heute besteht, massiv verändert würde. Die Kosten der Aufnahme von Nettoempfängern würden also nicht mehr von den Steuerzahlern des Gastlandes übernommen. Hier könnten sich Verbände, Kirchen oder Individuen, die die Hilfe von Migranten befürworten, selbst durch Übernahme der Kompensationszahlung als wirksame Unterstützer beweisen. Als problematisch dürfte sich dabei in manchen – sicherlich nicht in allen – Fällen erweisen, daß die eingeforderte Unterstützung für die Migration häufig ein Lippenbekenntnis ist und nach Möglichkeit mit den finanziellen Ressourcen anderer Bevölkerungsgruppen („die Reichen“) abgedeckt werden sollte.
Schließlich hat das Konzept auch Umsetzungsprobleme. So lassen sich für ein Individuum nicht besonders leicht die Beiträge und die Leistungsinanspruchnahme berechnen. Freilich gibt es hier Möglichkeiten der Näherung wie sie beispielsweise von Versicherungen genutzt werden. Zudem setzt das Konzept voraus, daß Individuen, die nicht die entsprechende Zahlung leisten können, auch bei der versuchten Einreise abgewiesen werden können. Das Transfersystem erfordert in diesem Zusammenhang zum einen strenge Grenzkontrollen, um die illegale Einwanderung einzudämmen. Andererseits müßte ein Clearing-System zwischen den Staaten eingerichtet werden, über das die Abrechnung der Transferzahlungen ablaufen kann. Auch mit Angehörigen von Staaten, die der Einrichtung dieses Migrationsregimes nicht zustimmen, müßten Sonderregelungen getroffen werden. Insgesamt könnte also durch die Übertragung des Transfersystems auf die Migration die Migration insgesamt effizient gestaltet werden.
Quellen
Beine, M., Docquier, F., & Özden, Ç. (2011). Diasporas. Journal of Development Economics 95(1), 30-41.
Daumann, F. (2000). Nationale Krankenversicherungssysteme Europas im Systemwettbewerb. Jahrbücher für Nationalökonomie und Statistik 220, 527-540.
Daumann, F. (2023). Grundlagen der Sportökonomie, 4. Aufl. München: UVK/Lucius.
Daumann, F. & Klöcker, J. A. (2024). International migration and the transfer system: A method to limit brain drain and excessive use of the welfare state. Economics Bulletin, 44 (4), pp. 1464-1468.
Daumann, F. (1995). Faktormobilität, Systemwettbewerb und die Evolution der Rechtsordnung, in: Oberender, P., & M. E. Streit (Hrsg.), Europas Arbeitsmärkte im Integrationsprozeß, Baden-Baden: Nomos, 53-69.
Klöcker, J. A., & Daumann, F. (2023). What drives migration to Germany? A panel data analysis. Research in Economics 77(2), 251-264.
Sinn, H.-W. (1997). The Selection Principle and Market Failure in Systems Competition. Journal of Public Economics 66, 247-274.
Tiebout, C. M. (1956). A Pure Theory of Local Expenditures. Journal of Political Economy 64, 416-424.
Woolcock, S. (1994). The Single European Market: Centralization or Competition among National Rules?, London: Royal Institute of International Affairs.
- „Controlled disruption“ für die deutschen Streitkräfte - 17. Dezember 2025
- Die Enhanced Games 2026
Diabolus ad portam? - 29. Oktober 2025 - Die UEFA und die weitere Erosion des National-League-Principles - 18. Oktober 2025