Ein 260 Jahre alter Text liest sich wie eine Warnung vor heutigen Handelskriegen. Anders Chydenius durchschaute bereits 1765, was Politiker heute wieder vergessen: Protektionismus schadet allen.
Alte Reflexe, neue Probleme
Die Versuchung ist groß, die eigene Wirtschaft durch Zölle, Quoten und „Buy National“-Gebote zu schützen. Donald Trump verspricht Strafzölle auf Waren unterschiedlicher Staaten, China und die EU antworten mit und diskutieren über Vergeltungsmaßnahmen. Überall wächst der Ruf nach nationaler Wirtschaftssouveränität. Was heute als moderne Industriepolitik verkauft wird, ist jedoch ein uraltes Rezept mit bekannten Nebenwirkungen.
Einen besonders scharfsichtigen Kritiker dieser Denkweise findet man dort, wo ihn niemand vermutet: in den Schriften eines finnischen Landpfarrers aus dem 18. Jahrhundert. Anders Chydenius (1729–1803) analysierte die verheerenden Folgen protektionistischer Politik mit einer Klarheit, die heutige Debatten beschämt.
Der skandinavische Frühliberale
Chydenius war ein Mann der Widersprüche und des Mutes. Als Geistlicher predigte er von der Kanzel, als Ökonom zerlegte er mit Denkschriften die Wirtschaftspolitik seiner Zeit. Beim schwedischen Reichstag von 1765/66 kämpfte er gegen Handelsbeschränkungen und für Pressefreiheit – mit einem Erfolg, der ihn prompt seinen Sitz kostete.[i]
Seine Schrift „Die Quelle der Schwäche unseres Landes“ von 1765 liest sich wie eine Blaupause moderner Freihandelsargumente. Chydenius analysierte die schwedische „Warenverordnung“ von 1724/26, die ausländischen Händlern verbot, andere als ihre eigenen Landesprodukte zu importieren. Das Ergebnis: ein System, das nur wenigen Privilegierten nutzte, während es Land und Bürger verarmte.
Protektionismus als Elitenprojekt
Mit bestechender Logik zeigt Chydenius auf, wer von Handelsbeschränkungen profitiert: „Die Kaufleute in unseren größeren Stapelstädten erkannten recht deutlich, dass die Engländer und Holländer ihre Pläne in den großen Häfen des Landes behinderten: sie unterboten sie im Salzhandel oder zwangen sie, ihren Mitbürgern Schnäppchen anzubieten.“(Die Quelle der Schwäche unseres Lande, 1765, auch nachfolgend)
Die Lösung war ein Kartell per Gesetz. Die Warenverordnung schuf künstlich Monopole, die einigen wenigen Händlern enorme Gewinne bescherten, während die Allgemeinheit unter Versorgungsengpässen und hohen Preisen litt. Salz, ein lebensnotwendiges Gut, wurde so knapp und teuer, dass auf jedem folgenden Reichstag „klägliche Beschwerden über seine Knappheit und seinen Mangel“ zu hören waren.
Was Chydenius vor 260 Jahren beschrieb, kennen wir aus heutigen Handelskonflikten: Gut organisierte Produzenten setzen Schutzmaßnahmen durch, während die breite Masse der Verbraucher die Kosten trägt – und dabei oft nicht einmal bemerkt, woher die Preissteigerungen stammen.
Der Preis des Schutzes
Chydenius‘ Analyse der Warenverordnung offenbart das ganze Ausmaß protektionistischer Kollateralschäden. Die Holländer reagierten 1725 mit Vergeltungsmaßnahmen und schlossen schwedische Schiffe vom lukrativen Kolonialhandel aus. „Dadurch wurden die Ausländer daran gehindert, unsere Häfen in der gleichen Anzahl wie zuvor anzulaufen, da sie neben den Produkten ihres eigenen Landes keine Auswahl von in Schweden nachgefragter Waren mitbringen durften.“
Das Ergebnis war eine Spirale der Vergeltung, die allen schadete. Schwedische Exporte sanken, Importpreise stiegen, weil der Wettbewerb unter den Anbietern abnahm. Am Ende litt die gesamte Volkswirtschaft unter einem System, das eigentlich ihren Wohlstand mehren sollte.
Besonders bitter: Die kleineren Hafenstädte, die mangels eigener Exportgüter nicht direkt mit Salzexporteuren handeln konnten, mussten nun „ihr gesamtes Salz bei den wenigen Exporteuren anfordern, die in einigen größeren Städten zu finden sind. Sie mussten es zu einem Tarif bezahlen, bei dem das Salz seine Fracht selbst decken konnte, also ziemlich teuer.“ Bei den Holländern hatten sie es noch weitaus günstiger bekommen.
Transparenz als Gegengift
Neben seiner ökonomischen Analyse entwickelte Chydenius ein zweites Instrument gegen Machtmissbrauch: radikale Transparenz. Seine „Denkschrift über die Pressefreiheit“ von 1765 führte zur weltweit ersten Pressefreiheitsverordnung und zum schwedischen Öffentlichkeitsprinzip, das Bürgern bis heute Zugang zu Regierungsdokumenten gewährt.
„Die Freiheit eines Volkes wird nicht nur durch Gesetze, sondern auch durch öffentliche Information und Kenntnis ihrer Anwendung bewahrt“, argumentierte er. Ohne Transparenz könnten weder die Reichsstände „die erforderliche Kenntnis besitzen, um gute Gesetze zu schaffen“, noch die Bürger ihre Rechte wahrnehmen.
Diese Verbindung von Handelsliberalismus und Informationsfreiheit war revolutionär. Chydenius erkannte: Protektionistische Seilschaften gedeihen im Verborgenen. Nur wenn ihre Machenschaften öffentlich werden, verlieren sie ihre Wirksamkeit.
Ordnung durch Freiheit
In seinem Hauptwerk „Der nationale Gewinn“ (1765) entwickelt Chydenius eine Theorie spontaner Ordnung, die später von Adam Smith, nahezu sicher unabhängig, popularisiert wurde: „Jeder Einzelne strebt nach seinem eigenen Vorteil. Diese Neigung ist so natürlich und notwendig, dass jede Gesellschaft auf der Welt darauf basiert.“ (Der nationale Gewinn, 1765, § 5)
Nicht Planung von oben, sondern freie Kooperation von unten schafft Wohlstand. Wird „jemand durch öffentliche Subventionen gezwungen oder dazu verleitet .., in einer anderen Branche zu arbeiten als in der, in der er den höchsten Lohn verdient, … wird dies unweigerlich zu einem Verlust für die Nation führen.“ (ebenda)
Diese Erkenntnis trifft den Kern heutiger Industriepolitik. Ob Batteriefabriken, Chipproduktion oder grüne Technologien – staatlich gelenkte Investitionen entstehen meist dort, wo private Anleger das Risiko scheuen. Das Signal ist eindeutig: Die volkswirtschaftliche Rendite liegt unter den Kapitalkosten – das Risiko-Ertragsverhältnis ist unattraktiv.
Moderne Relevanz
Chydenius‘ Argumente haben nichts an Schärfe verloren. Seine Warnung vor der „Vermischung von bürokratischer Organisation und spontaner Ordnung“[ii] beschreibt präzise das Problem heutiger Industriepolitik. Behörden sind „für die Bearbeitung klar abgegrenzter und überschaubarer Probleme konzipiert. Diese können kompliziert sein, aber nicht komplex und dynamisch.“
Genau diese Komplexität zeichnet aber moderne Märkte aus. Wer heute chinesische Solarpanels mit Zöllen belegt, übersieht die deutschen Installateure, die dadurch Aufträge verlieren. Wer europäische Chipfabriken subventioniert, ignoriert die Opportunitätskosten in anderen Bereichen.
Der Ausweg
Chydenius bietet mehr als Kritik – er zeigt Alternativen auf. Statt Märkte zu lenken, sollte der Staat „jene Hindernisse beseitigen, die durch bestehende Gesetzgebung der Bevölkerung auferlegt wurden.“ Sein Vorschlag für Lappland skizziert eine Sonderwirtschaftszone mit „vollständige[r] und uneingeschränkte[r] Handelsfreiheit“ – ein Modell, das von Hongkong bis Dubai erfolgreich umgesetzt wurde. (Vorschlag zur Verbesserung von Lapplannd, 1794/95)
Die Lehre ist einfach: „Vorschriften, Verordnungen, ausschließliche Privilegien, Verbote aller Art bis hin zu offenkundigem Neid zwischen Staaten und Bürgern sind die Schritte, mit denen Schweden beschlossen hat, die Spitze seines Glücks zu erklimmen. Was für eine sinnlose Verkomplizierung und vergebliche Anstrengung!“ (Die Quelle der Schwäche unseres Landes, 1765)
Renaissance der Vernunft
In einer Zeit, in der Handelskriege als Normalität gelten und Industriepolitik als Lösung aller Probleme gepriesen wird, lohnt sich die Lektüre eines finnischen Pfarrers, Ökonomen und Reformer. Anders Chydenius erinnert uns daran, dass ökonomische Vernunft zeitlos ist – und dass die Versuchungen des Protektionismus so alt sind wie die Argumente dagegen.
Seine Botschaft ist hoffnungsvoll: Prosperität entsteht nicht durch Schutz vor dem Wettbewerb, sondern durch die Freiheit, an ihm teilzunehmen. „Die Natur selbst ist dagegen und beweist, dass nichts als Freiheit und Menschenliebe die geeigneten Baustoffe sind, um Gesellschaften mit Macht und Ansehen auszustatten.“ (Die Quelle der Schwäche unseres Landes, 1765)
Vielleicht ist es Zeit, wieder auf den vergessenen Finnen zu hören.
[i] Ausgewählte Texte sind erstmals in deutscher Sprache verfügbar: Anders Chydenius: Reformer, Ökonom, Geistlicher, Ausgewählte Texte, hg. von Michael von Prollius, edition g. 133, Hamburg 2025.
[ii] Michael von Prollius: Der ordnungspolitische Unterschied. Kooperation statt Weisung, in: Wirtschaftliche Freiheit am 25.12.2024, auch nachfolgend; Link: https://wirtschaftlichefreiheit.de/wordpress/?p=38830

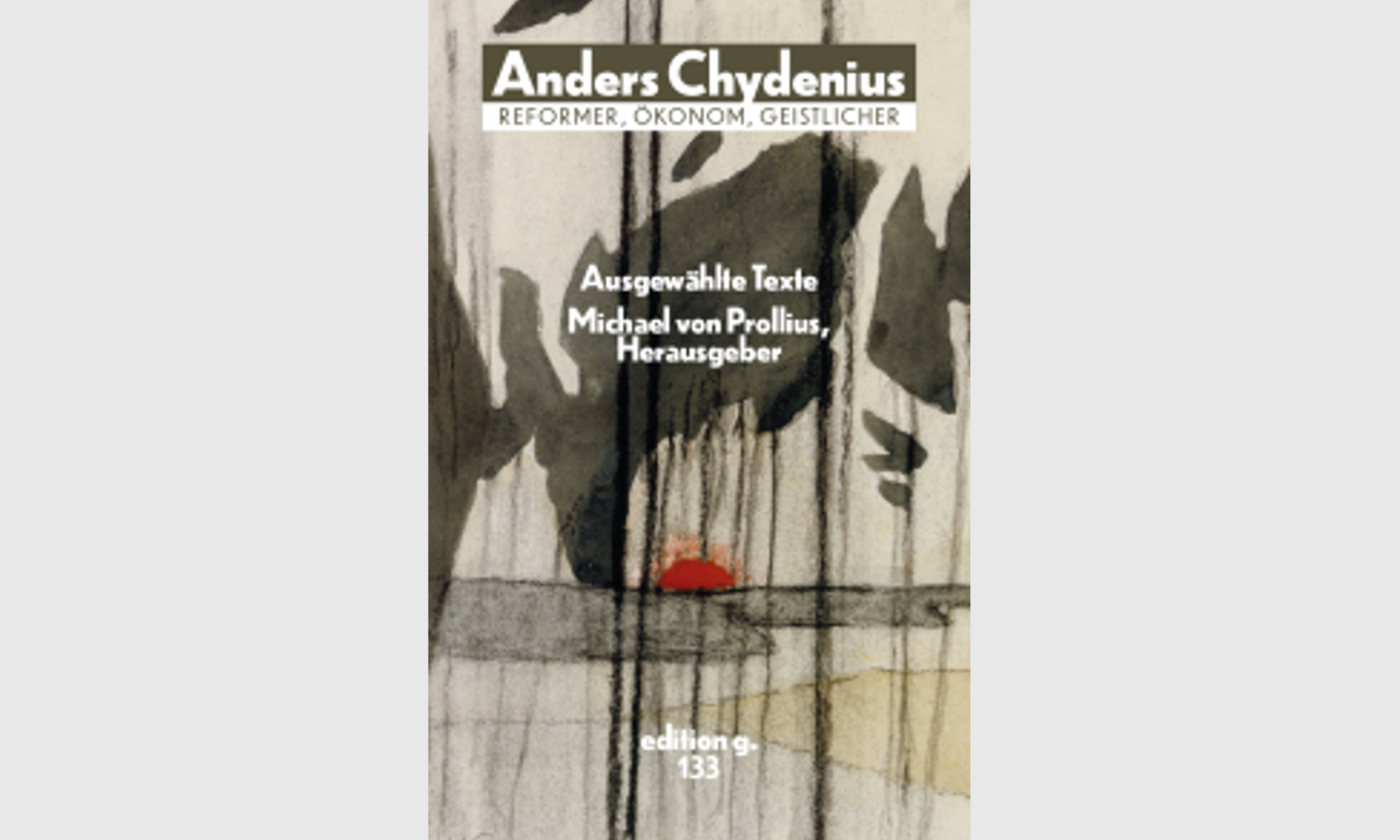
Eine Antwort auf „Gastbeitrag
Der vergessene Freidenker
Was ein finnischer Pfarrer über Protektionismus wusste “