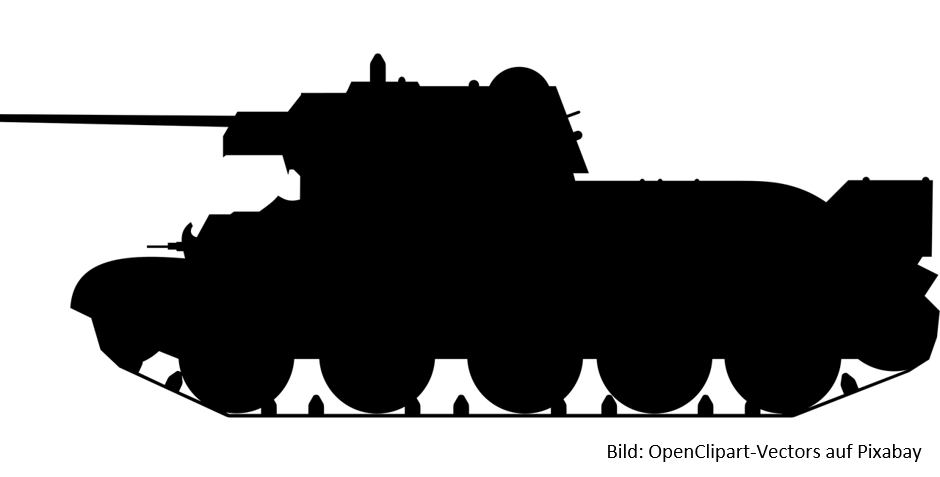Wie können wir unsere liberalen Demokratien schützen
Das Internet und die sozialen Medien haben die Medienlandschaft radikal verändert. Hatte man zunächst geglaubt, dass dies die Gesellschaft weiter demokratisieren würde, so stellt man heute fest, dass die neue Medienlandschaft die Menschen bezüglich der Grundüberzeugungen einer liberalen und rechtsstaatlichen Demokratie entwurzelt. In die daraus entstehende Orientierungslosigkeit stoßen bewusst und aggressiv die Feinde der Demokratie im inneren ebenso wie im äußeren. Russland, China und auch die neue Trump-Administration in den USA versuchen aktiv, auf diesem Wege die liberalen und rechtsstaatlichen Demokratien in ihren Grundfesten zu erschüttern. Wir dürfen diesem Spiel nicht einfach untätig zusehen, sondern müssen aktiv darauf reagieren.