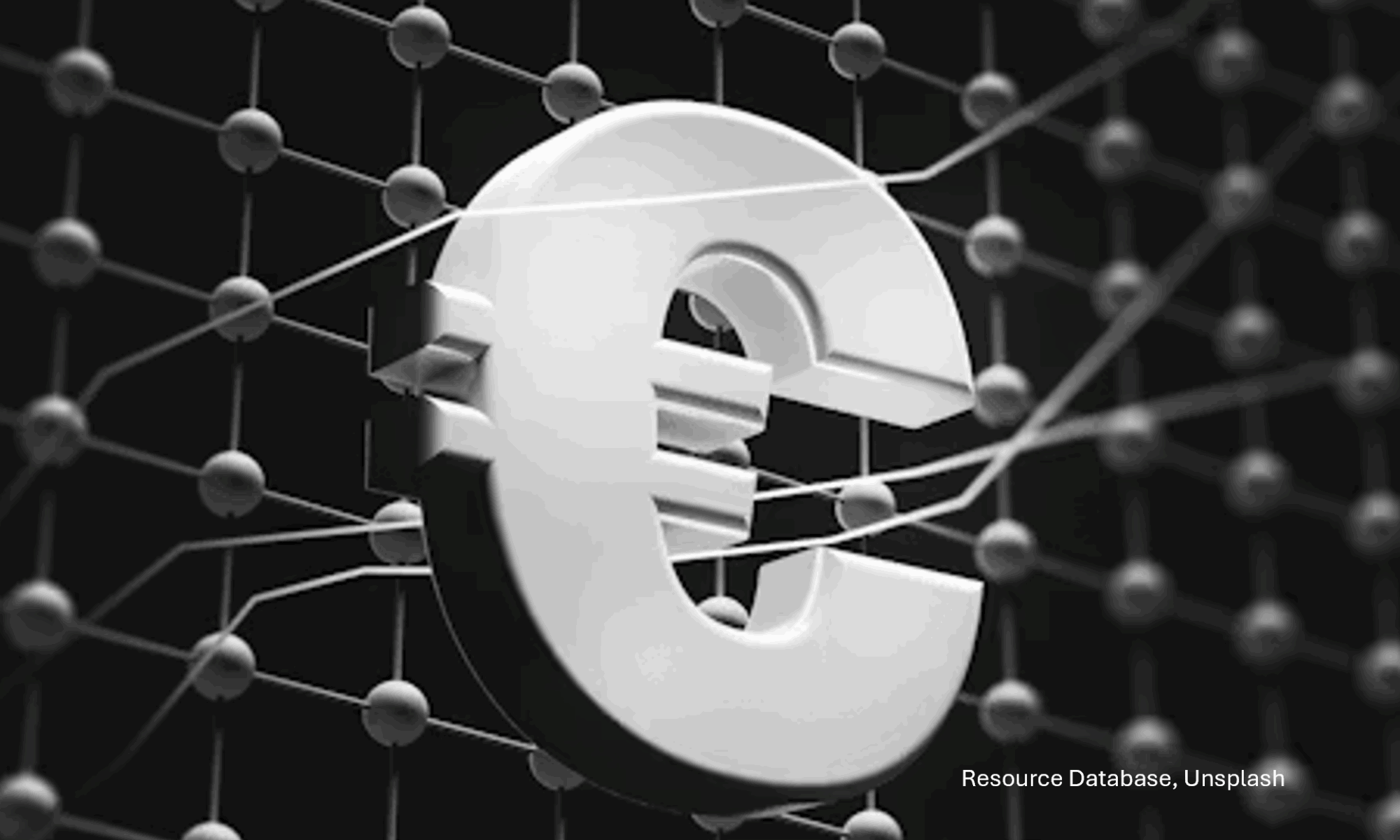Drifting Apart
Digitales Bargeld in den USA und in der Eurozone
Während das Eurosystem Anfang November einen weiteren Schritt zur Einführung des digitalen Euros gegangen ist, hatte US-Präsident Trump bereits Anfang 2025 die Ausgabe und den Gebrauch eines digitalen Dollars untersagt. Die Eurozone und die USA gehen damit völlig unterschiedliche Wege bei der Digitalisierung ihrer Zahlungswege. Warum ist das so und was wird sich durchsetzen?