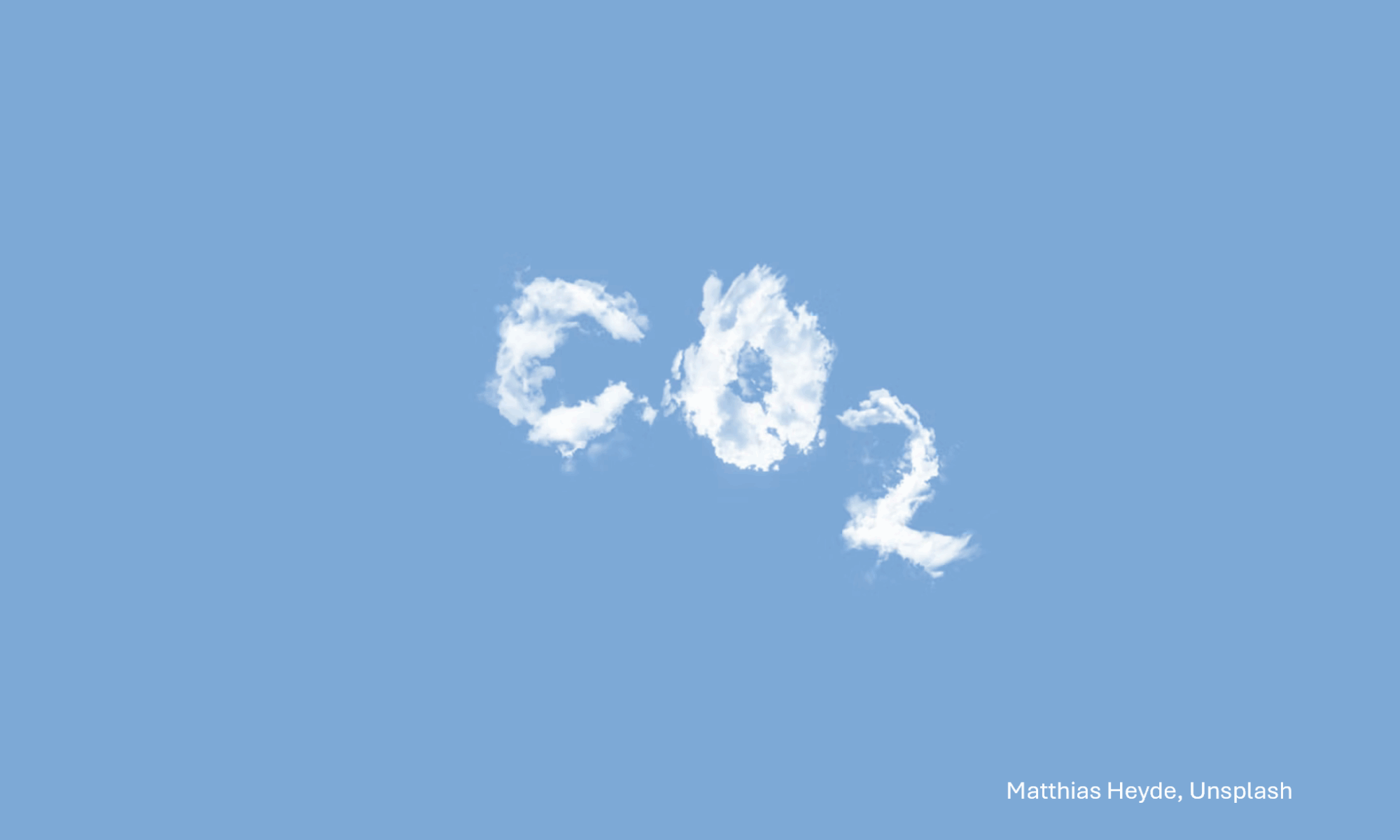Europäischer Emissionshandel in der Kritik (1)
Klima im Wandel
Wende in der (europäischen) Klimapolitik?
Die Klimapolitik ist weltweit unter Druck. Auch das europäische Emissionshandelssystem (ETS) ist in der Kritik. Dem weltweiten Klima hilft es (fast) nichts, den industriellen Niedergang in der EU beschleunigt es. Das eigentliche Problem ist aber weniger der (unvollkommene) Zertifikatehandel. Es fehlt eine weltweit aufeinander abgestimmte Klimapolitik. Das ETS kann das Kooperations-Problem nicht lösen. Ohne Kooperation steckt Europa aber in der Klimapolitik-Falle. Wenn es sich wirtschaftlich nicht weiter selbst zerstören will, muss es bei den Klimazielen abspecken. Macht das die Politik nicht bald, werden es die Wähler machen.