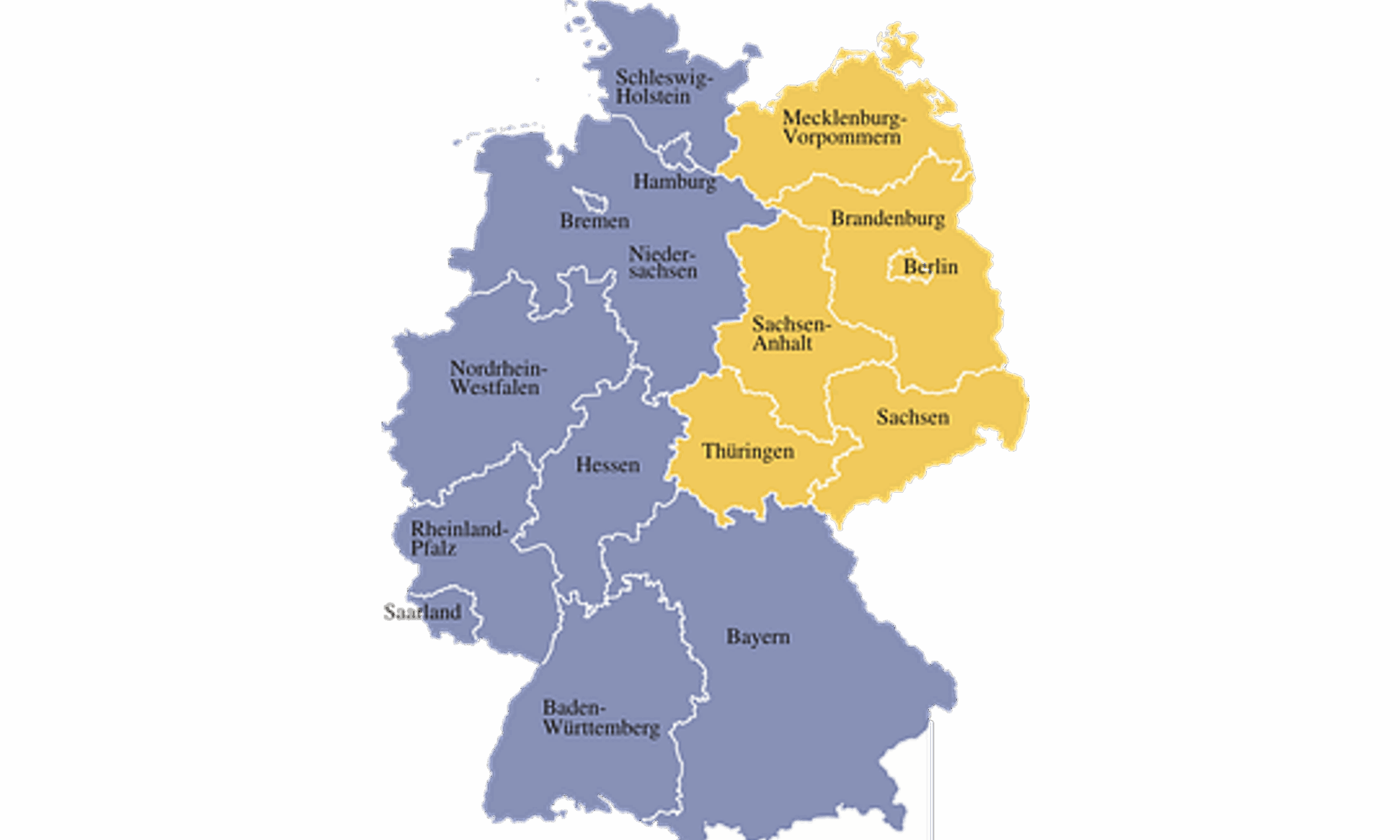Gastbeitrag
Mehr Wettbewerbsföderalismus wagen!
Deutschland befindet sich in einer Politikverflechtungsfalle, in der kollektive Verantwortungslosigkeit zu Erstarrung führt.
Die wesentlichen Vorteile des Föderalismus – Machtbegrenzung, demokratische Nähe sowie Lern- und Innovationschancen durch institutionellen Wettbewerb – können so nicht zum Tragen kommen. Eine systematische Neujustierung hin zu einem stärker wettbewerblichen Föderalismus tut daher dringend Not.