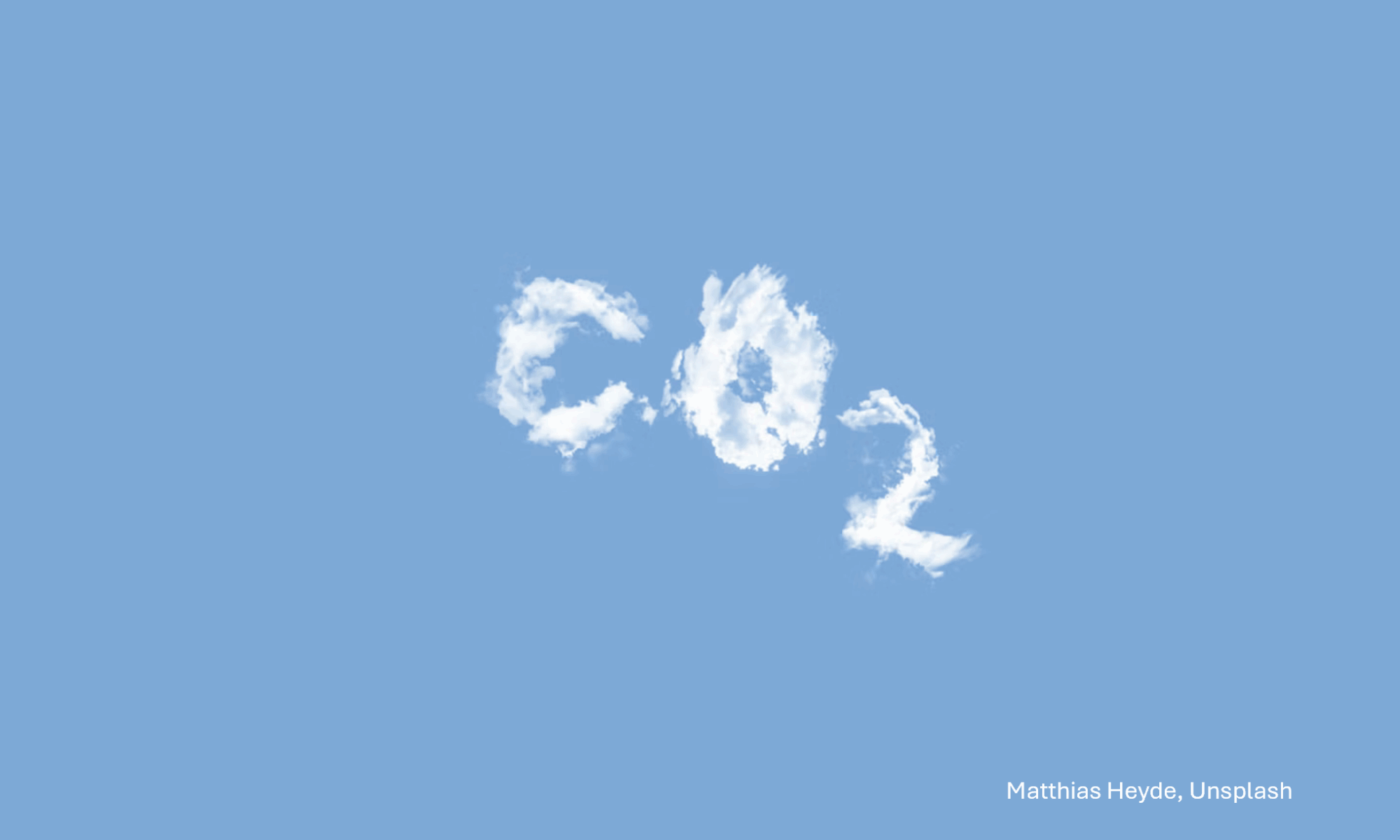Die europäische Integration stagniert. Das könnte sich ändern. Den Anstoß könnte Donald Trump geben, ein bekennender Gegner der Europäischen Union. Seine Politik schafft Anreize für die EU, die Strategie der politischen Integration zu überdenken und die Kompetenzordnung vom Kopf auf die Füße zu stellen. Die zollpolitischen Raubzüge des amerikanischen Präsidenten gegen die EU sind ein Weckruf für Europa, die eigene wirtschaftliche Basis zu stärken, intern (Europäischer Binnenmarkt) und extern (weltweite Freihandelsabkommen). Die alte Idee, Europa wirtschaftlich stärker zu integrieren, um politisch schneller voranzukommen, könnte wiederbelebt werden.