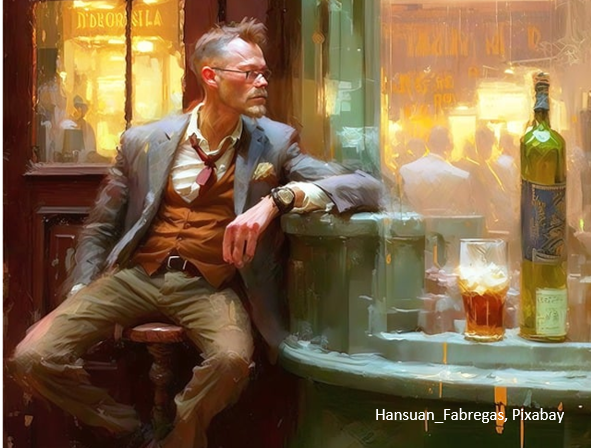Dauerhafte Erhöhung der Verteidigungsausgaben
Nur mit und nicht ohne Schuldenbremse möglich
Die Schuldenbremse bildet keine Hürde, sondern eine Voraussetzung für dauerhafte Abschreckung durch nachhaltig finanzierte Verteidigungsanstrengungen.