Das Wort Identitätspolitik erinnert an den rechten Rand des politischen Spektrums, und nicht ohne Grund. Man denke nur an die ursprünglich in Frankreich gegründete Identitäre Bewegung, die seit knapp zehn Jahren auch in Deutschland aktiv ist. Sie weist jeder ethnischen Gruppe ihren angeblich angestammten Lebensraum zu und setzt sich für eine Art Re-Segregation der aus ihrer Sicht ethnisch zu plural gewordenen westlichen Gesellschaften ein. In Deutschland wird die Identitäre Bewegung als rechtextreme Gruppierung eingestuft und vom Verfassungsschutz beobachtet.
Ursprünglich stammt der Begriff der Identitätspolitik allerdings keineswegs von rechts. Anlass war vielmehr etwas, was man eigentlich mit Pluralität, Diskriminierungsfreiheit und der universellen Gültigkeit des Rechts für alle Mitglieder einer Gesellschaft verbindet. Nennen wir es den rechtlichen und gesellschaftlichen Universalismus. In dessen langer Entstehungsgeschichte hat sich immer wieder Unmut darüber aufgestaut, dass es mit der Verwirklichung universell geltenden Rechts meist nur schleppend voranging. So ging es 1977 auch den Aktivistinnen des Combahee River Collective, einer Gruppe von schwarzen und lesbischen Frauen in den USA, die zugleich drei diskriminierten Gruppen angehörten. Ihr Unmut veranlasste sie aber nicht zu einer Verstärkung ihres Drucks in Richtung auf universelle Rechte, sondern vielmehr zu einer Abkehr davon. In ihrem Aufruf „A Black Feminist Statement“[1] gingen sie weg von der Forderung, die Merkmale „weiblich, schwarz, homosexuell“ als ebenso irrelevant für ihre rechtliche und gesellschaftliche Stellung zu erachten wie irgendwelche anderen Attribute.
Stattdessen leiteten sie nunmehr aus diesen Attributen eine Identität ab, zu welcher nur noch sie das Recht haben sollten, Zugehörigkeit zu reklamieren. Zugleich verkündeten sie, fortan allein für die Rechte ihrer Identität zu streiten und beendeten so ihren Beitrag zum gemeinsamen Engagement aller Diskriminierten für universelle Rechte. Andere Menschen mit anderen Attributen mochten ihre jeweilige Identität für sich definieren und daraus wiederum Forderungen nach bestimmten Rechten ableiten. Aber das sollte nicht mehr das Problem des Combahee River Collective sein. Das Black Feminist Statement wird allgemein als der Startschuss dessen gesehen, was heute als linke Identitätspolitik bekannt ist: eine bewusste Abkehr vom gemeinsamen Streit aller Diskriminierten für den Universalismus.
So sehr sich auch ihre Motive unterscheiden, so haben rechte und linke Identitätspolitik doch eines gemein: Sie denken nicht in individuellen, sondern in kollektiven Identitäten. Die Rechten streben eine räumliche Trennung kollektiver Identitäten an, während die Linken sich die Gesellschaft wie ein Meer vorstellen, in dem vielerlei Inseln kollektiver Identitäten umherschwimmen und auf diese Weise eine Art kollektive Diversität der Gesellschaft erzeugen, welche gern und fälschlich mit der Vielfalt individueller Lebensentwürfe in einer offenen und toleranten Gesellschaft verwechselt wird. Denn der Wechsel von einer Identitätsinsel zu einer anderen liegt keineswegs im Ermessen eines individuellen Menschen. Das kann er nicht und, wie wir noch sehen werden, darf er das auch nicht. Denn Identitäten sind in einem gewissen Sinne exklusiv.
Es mag Zufall sein, aber die Entwicklung linker Identitätspolitik ging zeitlich einher mit dem Siegeszug eines wissenschaftstheoretischen Konzepts in bestimmten sozialwissenschaftlichen Kreisen. Dabei handelt es sich um den Konstruktivismus, dessen radikale Variante mit der linken Identitätspolitik eine Art Symbiose einging. Im Sinne des radikalen Konstruktivismus gibt es strikt keine objektiven und vom jeweiligen Betrachter unabhängigen Wahrheiten. Vielmehr sind sie alle nur Konstruktionen, welche allein aus der jeweiligen Perspektive erkannt und anerkannt werden können, aus der sie jeweils stammen. Man mag das an einem Beispiel aus der Tierwelt illustrieren. Wer nicht über das Ultraschallsystem der Fledermäuse verfügt, kann die – in der Regel dunkle – Welt, in der sich diese nachaktiven Tiere bewegen, nicht so wahrnehmen wie sie. Für eine Fledermaus ist die Nachtwelt nämlich in einem gewissen und für uns nicht vorstellbaren Sinne taghell. Und tatsächlich ist die Frage von hell oder dunkel keine objektive, denn es ist nur unser Gehirn, das mit Hilfe unserer Augen bestimmte Strahlen, die es nur tagsüber gibt, in ein helles Bild übersetzt. Für andere Wesen kann das ganz anders sein. Daher ist unsere Lebenswelt tagsüber tatsächlich nicht objektiv hell, sondern nur in der Wahrnehmung von Menschen und vielen Tieren.
Diese unbestrittenen Einsichten überträgt der radikale Konstruktivismus nun aber kühn auf alle Formen von Wahrnehmungen und definiert so seinen höchst umstrittenen relativistischen Wahrheitsbegriff: Demnach gibt es für jede Sache beliebig viele gleichrangige Wahrheiten. Jede davon folgt einer von vielen möglichen Konstruktionen von Wirklichkeit, aber jede dieser Konstruktionen ist nur aus einer bestimmten Perspektive heraus wahr. Das passt nahtlos in das identitätspolitische Konzept. Man muss nur die Perspektive durch den Begriff Identität ersetzen, und schon folgt: Für jemanden, der nicht die relevante Identität aufweist, ist die aus dieser Identität heraus gewonnene soziale Konstruktion von Wirklichkeit weder wahr noch nachvollziehbar. So wie ein Mensch nicht in die Wahrnehmungswelt einer Fledermaus hineinschlüpfen kann, so kann er auch nicht per Willensentscheid von seiner Identitätsinsel auf eine andere wechseln. So wie die Nacht für Menschen wahrhaftig eine dunkle und für andere Wesen wahrhaftig eine helle ist, so lässt sich eine objektive Beschaffenheit sozialer Tatbestände nicht unabhängig von der Identitätszugehörigkeit des Betrachters bestimmen. Diese zunächst sehr abstrakte Behauptung hat längst praktisch greifbare Folgen, die wir alle aus öffentlichen Diskursen kennen:
- Es geht in öffentlichen Diskursen zunehmend nicht mehr darum, was jemand sagt, sondern vielmehr darum, wer es sagt. Das ist durchaus folgerichtig, denn nur aus einer bestimmten Identität heraus lässt sich eine gesellschaftlich erwünschte Wahrheit konstruieren – was immer das sein mag. Um die zu erlangen, müssen alle Diskussionszusammenhänge – ob Seminar, Arbeitsplatz, Talkshow oder was sonst – vor ihrer Entstehung auf die geeignete Identität der Teilnehmer überprüft werden. Damit ist klar, was nicht geht: beispielsweise eine Gruppe von Mitgliedern der aus den Attributen „männlich, weiß, älter“ bestehenden Identität, die im Fernsehen über Rassismus diskutiert. Kommt so etwas doch vor, so wird sofort ein Skandal daraus konstruiert, denn eine aus dieser Identität heraus konstruierte Wahrheit kann nicht erwünscht sein.
- Die behauptete Unmöglichkeit, erwünschte Wahrheiten aus ungeeigneten Identitäten heraus zu konstruieren, erstreckt sich auch auf die kulturelle Welt und die Gefühlswelt. Daher gibt es vor allem in den USA inzwischen verbreitet lautstark vorgetragene Forderungen, Charaktere aus bestimmten Identitäten in Film oder Theater nur noch von Angehörigen ebenjener Identitäten spielen zu lassen. So wird skandalisiert, wenn ein afro-amerikanischer Sklave von einem weißen Schauspieler gespielt wird; oder, wenn ein Homosexueller von einem Heterosexuellen gespielt wird; oder eine Frau von einem Mann. Die Forderungen werden teils durch lautstarke Aktionen und öffentliche Boykottaufrufe untermauert.
- Unter dem Begriff der „kulturellen Aneignung“ definiert linke Identitätspolitik einen neuen Tatbestand illegitimen Verhaltens. Ansatzpunkt ist ein tatsächliches Unrecht: der von westlichen Kolonialherren in großem Stil betriebenen Kunstraub, dessen Diebesgut skandalöser Weise bis heute in unseren Museen zu bewundern ist. Um den Tatbestand der kulturellen Aneignung zu konstruieren, werden die geraubten Kunstschätze nun aber mit kollektiven Kulturmerkmalen, Traditionen und Gebräuchen gleichgesetzt, welche im Gegensatz zu den Kunstschätzen niemals irgendwelchen Menschen gehört haben. Daher hat der daraus konstruierte Tatbestand der kulturellen Aneignung mit Kunstraub schon im Ansatz nichts zu tun. Dennoch wird daraus mit bisweilen militantem Nachdruck gefolgert, dass sich niemand mehr kulturelle Gebräuche oder Merkmale fremder Identität zu eigen machen dürfe. So ist es seit einiger Zeit beispielsweise ein bedenklicher Akt kulturelle Aneignung, wenn ein Europäer Rasta-Locken trägt oder die Kleidung indigener Völker. Vor nicht allzu langer Zeit galt man damit noch als besonders weltoffen und kultursensibel. Das ist vorbei. Schon wurden in den USA nicht-asiatische Kantinenbetreiber bedroht und zu öffentlichen Entschuldigungen genötigt, weil sie es gewagt hatten, asiatische Wok-Gerichte anzubieten; und von weißen Amerikanern betriebene Yoga-Schulen wurden wegen kultureller Aneignung attackiert – nicht etwa von Indern, sondern von anderen weißen Amerikanern.
- Schließlich wurde das vermeintliche Recht der Mitglieder jedweder Identitäten entwickelt, von identitätsfremden Wahrheiten, Gebräuchen, Redewendungen oder sozialen Umgangsformen unbedingt verschont zu bleiben, weil alles das angeblich zu schwerwiegenden Verletzungen ihrer Identitätszugehörigkeit führt. Dies gilt vor allem an Schulen und Universitäten, wo zwangsläufig die verschiedensten Identitäten zusammenkommen, was aus universalistischer Sicht eigentlich gar nicht genug begrüßt werden könnte. Aber dass Frauen mit der Logik von Männern konfrontiert werden, ist nun kaum mehr zumutbar; oder dass Angehörige bestimmter Minderheiten mit teils jahrhundertealten Schriften von Klassikern konfrontiert werden, welche damals verbreitete und diskriminierende Klischees noch nicht als solche erkannt hatten, ist ihnen auch dann nicht zuzumuten, wenn es um die betreffenden Textstellen gar nicht geht. Diese Haltung linker Identitätspolitik ist natürlich Wasser auf die Mühlen rechter und religiös-fanatischer Gruppen, die sie sofort gern und ausgiebig auch für sich reklamieren. Folgerichtig klagten sie – manchmal unter dem Applaus linker Identitätspolitiker –, dass Muslime mit den liberalen Grundsätzen der Kultur ehemaliger westlicher Kolonialherren in unzumutbarer Weise überwältigt würden, noch dazu mit den dazugehörigen Vorstellungen zum Geschlechterverhältnis. Da fällt so manche Feministin zwischen zwei Identitätsinseln ins kalte Wasser. Von bestimmten Unterrichtseinheiten und erst Recht vom Sportunterricht will man seine Kinder befreien, um deren Identität nicht zu gefährden. Und um alles das sicherzustellen, gibt es an amerikanischen Universitäten längst sogenannte „Safe Spaces“, in die sich jeder Angehörige der jeweiligen Identitäten zurückziehen kann, um sich vor den als „Mikroaggressionen“ umgedeuteten Meinungsdiskursen ebenso wie vor der Pluralität des Universitätslebens zu schützen. Gemeinsame Seminare werden so irgendwann unmöglich, zumal klassische Literatur voll ist von Übergriffen gegen die Unverletzlichkeit der Identität: ihre Auffassungen, ihre genderunsensible Sprache, ihre Rollenklischees, ihre Unbefangenheit gegenüber dem in ihrer Zeit üblichen Kolonialismus oder gar der Sklaverei – das hören und lesen zu müssen, ist unerträglich und schreit nach Auszeit im Safe Space. Wie soll es auch ein US-Schüler mit afro-amerikanischen Wurzeln ertragen, Texte von und über Thomas Jefferson und George Washington lesen zu müssen, der beide selbst Sklavenhalter waren? Gar nicht, und dabei merkt man nicht einmal, dass man den Betroffenen die Fähigkeit abspricht, diese Dinge historisch einzuordnen. Stattdessen empfiehlt man ihnen die Flucht in Safe Spaces, wo sie freilich sogleich mit Islamisten, Kreationisten und sonstigen Opponenten der offenen Gesellschaft zusammentreffen.
Vielen gutmeinenden Streitern für Gerechtigkeit und Gleichstellung ist die konzeptionelle Unvereinbarkeit von Identitätspolitik mit dem Streit für die Gültigkeit universeller Rechte und Toleranz offenbar nicht klar. Deshalb handeln sie oft in den besten Absichten und glauben, für Toleranz, Offenheit und Gleichheit zu streiten, wenn sie überall Verstöße gegen den Respekt vor kollektiven Identitäten wittern, vermeintliche Grenzübertritte laut klagend anprangern und öffentliche Entschuldigungen fordern, wo es nichts zu entschuldigen gibt. Beklagenswerter Weise knicken die fast immer zu Unrecht Beschuldigten unter dem öffentlichen Druck allzu oft ein:
- Im Jahre 2019 entschuldigte sich in der Folge eines mächtigen Empörungsrituals der kanadische Regierungschef Justin Trudeau sichtlich zerknittert öffentlich dafür, dass er sich 18 Jahre zuvor anlässlich einer Art Themenparty unter dem Motto „Arabische Nächte“ das Gesicht schwarz geschminkt hatte. Dabei hatte Trudeau nur einen Sultan abgeben wollen, und viele Sultane waren von dunkler Hautfarbe. Was ist schlimm daran, wenn man erst einmal die universalistische Einsicht verinnerlicht hat, dass Hautfarbe für die Wertigkeit von individuellen Menschen ebenso wie für Kulturen bedeutungslos ist? Nichts! Aber der Punkt ist sowieso ein anderer: Dunkle Hautfarbe darzustellen, steht nach identitätspolitischer Logik nur Dunkelhäutigen zu. Deshalb gehört „black facing“ ebenso wie „yellow facing“ zu den schlimmsten Vergehen gegen die identitätspolitische Sittenlehre. Denn für linke Identitätspolitiker ist Haut gerade kein unwichtiges Detail mehr, sondern ein essentielles Identitätsmerkmal. Es müsste sie eigentlich stutzig machen, dass rechte Identitätspolitiker das immer schon so gesehen haben.
- Die grüne Politikerin Bettina Jarasch entschuldigte sich öffentlich, nachdem sie in einem Video-Interview im Rahmen des Landesparteitags der Grünen im März 2021 erzählt hatte, als Kind den Berufswunsch des „Indianerhäuptlings“ gehegt zu haben. Während sie sich öffentlich entschuldigte und ihre „unreflektierte Wortwahl“ ebenso wie ihre „unreflektierten Kindheitserinnerungen“ reumütig bedauerte, wurde ihre Äußerung aus dem Video geschnitten und durch einen verschwurbelten Hinweis darüber ersetzt, dass an dieser Stelle eine herabwürdigende Bezeichnung einer Volksgruppe verwendet worden sei. Nur hatte die kindliche Bettina bei ihren Indianerspielen gewiss nicht die indigene Bevölkerung vor Augen, die man respektvollerweise in der Tat heute so bezeichnen sollte, wie sie das wünschen. Vielmehr kannte die kleine Bettina nur ein Kunstprodukt, dessen Helden in dieser Form überhaupt nur in Filmen und Geschichten existierten – und die hießen dort Indianerhäuptlinge. Diese Kunstfiguren ihrer Kindheit in einem Interview so in Erinnerung zu rufen, wie sie damals hießen, ist nichts, wofür sich irgendjemand zu entschuldigen hätte.
- Im Dezember 2020 musste sich die französische Modedesignerin Isabel Marant öffentlich dafür entschuldigen, dass sie sich für ihre neue Kollektion von traditionellen Farbmustern indigener Völker aus Mexiko hatte inspirieren lassen, und im April 2020 entschuldigte sich die Dessous-Marke Berlei öffentlich dafür, dass sie in ihrer Kollektion Farbmuster verwendet hatte, welche an jene der von australischen Aborigines erinnert.
Die Liste lässt sich beliebig fortführen. Wer mag, gebe nur die Worte „Entschuldigung“ und „kulturelle Aneignung“ in seine Suchmaschine ein. Die Liste wird lang sein. Dass Kultur, Sprache und auch Wissenschaft immer auf vorgefundenen Mustern aufbauen, die man in mal mehr und mal weniger origineller Weise neu kombiniert und durch eigene Ideen ergänzt, kann kein vernünftiger Mensch bestreiten. Es ist ein Segen, dass wir Menschen das können. Der gesamte wissenschaftliche Fortschritt beruht ebenso darauf wie die immer neue und oft wunderbare Blüten treibende Kunst und Kultur. Oft schon wurde beklagt, dass letzteres immer mehr vom Westen dominiert werde, und diese Klagen haben durchaus ihre Berechtigung. Wenn es also glücklicherweise einmal anders herum verläuft, dann wird das aber gleich wieder beanstandet und mit dem frei erfundenen Tatbestand der kulturellen Aneignung delegitimiert. Dieser Widerspruch lässt sich nur auf eine Weise auflösen: alle Kultur, alle Kunst und alle Wissenschaft hat strikt auf ihrer jeweiligen Identitätsinsel zu bleiben.
Das sehen auch die rechten Identitätspolitiker so. Ihnen ist völlig klar, was sie da fordern. Aber wieso merken die linken Identitätspolitiker nicht, worauf ihre Ideen hinauslaufen? Die Welt ist groß und wir können uns nur wünschen, dass kreative Menschen sie mit offenen Augen erkunden, Inspirationen aufnehmen, sie verbreiten und zu Neuem weiterentwickeln; und wenn dabei bisweilen Dinge wie eine mit Pommes Frites belegte Pizza oder überbackener Döner herauskommen, so ist auch das in Ordnung. Man mag es ja mögen oder nicht. Aber es ist nie bei solch profanen Dingen geblieben. Sollten in solchen Zusammenhängen persönliche Urheberrechte verletzt werden, dann gibt es die Möglichkeit, zu klagen, und dafür gibt es Gerichte. Und wenn es weniger betuchten Menschen aufgrund ihrer wirtschaftlichen Lage oder ihrer Herkunft oder sonstiger Merkmale nicht möglich ist, ihre Rechte zu erstreiten, dann ist das nicht in Ordnung, dann muss man das öffentlich machen und dagegen vorgehen. Genau davon war über Jahrhunderte der Streit für universelle Rechte motiviert. Aber Kulturen und Gebräuche unter Urheberrechtsschutz zu stellen, hat damit gar nichts zu tun. Es ist eine absurde Verirrung, die auf der Gleichsetzung von Dingen beruht, die unterschiedlicher nicht sein könnten.
Hätten in den 1960er Jahren schon die Maßstäbe moderner linker Identitätspolitik gegolten, so hätten sich Musiker wie Eric Clapton, Jeff Beck oder die Rolling Stones und sogar die Beatles bei den Nachfahren der schwarzen Sklaven aus dem Mississippi-Delta öffentlich dafür entschuldigen müssen, dass sie deren herzzerreißende Klage- und Liebeslieder mit Hilfe elektrischer Gitarren neu interpretierten und damit spektakuläre Erfolge feierten. Was für eine widerliche kulturelle Aneignung! Dagegen sind die Dessous von Berlei eine Kleinigkeit (sind sie eh). Heute hätten Eric Clapton und all die anderen ihre Taten voller Scham öffentlich zu bereuen und mit tiefer Demut zu schwören, sie niemals zu wiederholen. Dumm nur, dass die Welt ärmer wäre ohne diese vermeintlichen Kunsträuber, und so steht zu befürchten, dass wir in Deutschland neben der Klassik vermutlich noch immer Marschmusik hören würden. Das dürfte dann wiederum die rechten Identitätspolitiker freuen.
Der eigentliche Skandal liegt deshalb ganz woanders. Nicht darin, dass vier alte weiße Männer im Fernsehen über Rassismus diskutieren; nicht darin, dass ein kanadischer Politiker sich einst als Sultan verkleidet und dazu sein Gesicht schwarz geschminkt hat; nicht darin, dass eine Politikerin sich öffentlich an ihren Kindertraum von der Kunstfigur eines Indianerhäuptlings erinnerte; und gewiss liegt der Skandal nicht darin, dass sich Modeschöpfer, Musiker und sonstige Kreative weltweit Inspirationen holen und entweder unverändert übernehmen oder zu neuen Kreationen fortentwickeln.
Der eigentliche Skandal ist vielmehr die Tatsache, dass diese frei erfundenen Missetatbestände zum Anlass genommen werden, die „Täter“ zu öffentlichen und demütigenden „Entschuldigungen“ zu nötigen und ihnen bei Unbotmäßigkeit mit gesellschaftlicher Vernichtung zu drohen. Wenn wir das alles zu Ende denken, dann entsteht vor unseren Augen eine Welt, die alles andere ist als getragen von freier und individueller Persönlichkeitsentwicklung, von Toleranz und vor allem von Respekt gegenüber den verschiedensten Menschen mit ihren jeweils unterschiedlichen kulturellen, familiären und persönlichen Hintergründen. Denn kollektive Identitäten sind nichts als von Menschen geschaffene gedankliche Konstrukte, die selbst gar nichts empfinden können. Respekt und Toleranz können nur Menschen empfinden. In einer toleranten und weltoffenen Gesellschaft sind allein sie dazu befugt, Identität zu bestimmen; ihre ganz persönliche Identität nämlich, in welche sie in freier Willensentscheidung die einzigartige Vielfalt ihrer ganz spezifischen kulturellen, familiären und sozialen Erfahrungen ebenso einfließen lassen wie die unverwechselbaren Stärken, Schwächen, Talente, Wünsche und Träume ihrer individuellen Persönlichkeit.
Identitätspolitik dagegen definiert exklusive und kollektive Identitäten, denen man im Zweifel gegen seinen Willen zugeordnet wird und von denen man umgekehrt ausgeschlossen bleibt, wenn man die nötigen Attribute nicht nachweisen kann. Wie letzteres geschehen soll, ist bislang ins Ermessen der selbsternannten Identitätswächter gestellt. Die linke Feministin und bekennende Universalistin Caroline Fourest merkt dazu sarkastisch an, dass man zwangsläufig irgendwann auf Gentests wird zurückgreifen müssen. [2] So absurd ist diese Folgerung nicht. Denn wie sonst sollte man hinreichende asiatische, afro-amerikanische oder indigene Identität nachweisen, um sich beispielweise für die Rolle in einem Theaterstück zu qualifizieren?
Identitätspolitik hat das Potenzial, im Namen der Toleranz eine Gesellschaft der Intoleranz, im Namen der Gleichstellung eine Gesellschaft der Diskriminierung, im Namen der Diversität eine Gesellschaft identitärer Segregation und im Namen kultureller Offenheit eine Gesellschaft engstirniger kollektiver und exklusiver Identitäten zu schaffen. Rollen in Film, Theater oder Hörspiel dürfen in einer solchen Welt nur noch mit Identitätsnachweis übernommen werden, über bestimmte Ethnien darf nur noch forschen, wer deren Identität aufweist, Probleme bestimmter Minderheiten darf nur noch diskutieren, wer diesen Minderheiten angehört. Musik, Mode und Kunst muss sich stets vor den Wächtern der kulturellen Provenienz rechtfertigen und bei Missachtung öffentlich und demütig Buße tun. Das alles ist keine dunkle Zukunftsvision, das alles ist bereits heute Realität, und am meisten ausgerechnet an den Orten, an denen der freie Austausch von Gedanken und Ideen selbstverständlich sein sollte! Aber Identitätspolitik von rechts und von links hat noch weit mehr Potenzial. Deshalb sind gerade Linke und erst Recht solche, die sich als linksliberal verstehen, aufgefordert, zu sehen, was viele von ihnen nicht sehen wollen: nicht zuletzt, dass linke Identitätspolitik rechter Identitätspolitik auf tragische Weise direkt in die Hände spielt.
— — —
[1] Siehe Combahee River Collective (1978), A Black Feminist Statement, in: Alison Jaggar; Paula Rothenberg, Hrsg., Feminist Frameworks, New York: McGraw Hill.
[2] Caroline Fourest (2020), Generation Beleidigt. Von der Sprachpolizei zur Gedankenpolizei. Über den wachsenden Einfluss linker Identitärer, Berlin: Edition Tiamat.
Podcast zum Thema:
Identitätspolitik: Belastung für Wirtschaft und Gesellschaft? Dr. Jörn Quitzau (Berenberg) im Gespräch mit Prof. Dr. Thomas Apolte (WWU)
- Über die Demokratie in Amerika
… und was wir daraus lernen können - 22. Dezember 2025 - Staatsverschuldung und Schuldenbremse
Ein Beitrag zur Erschütterung von Gewissheiten - 14. Juli 2025 - Wie können wir unsere liberalen Demokratien schützen - 30. März 2025

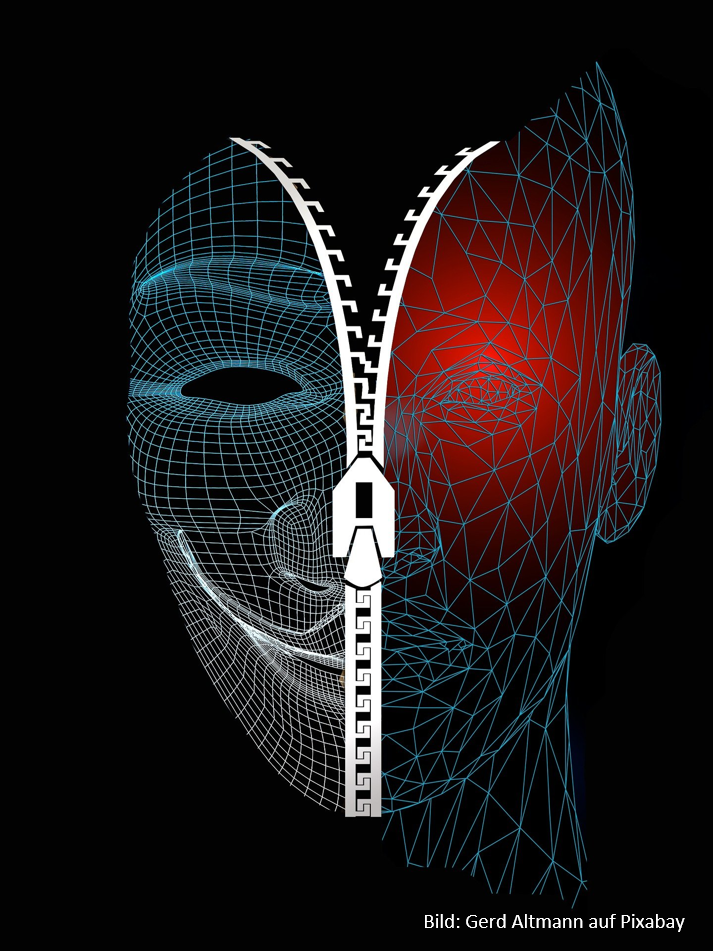
Es gibt zu diesem Thema ein gutes Buch von Friedrich Boettiger „der Mensch ohne Gesicht“ im Alibri Verlag erschienen.