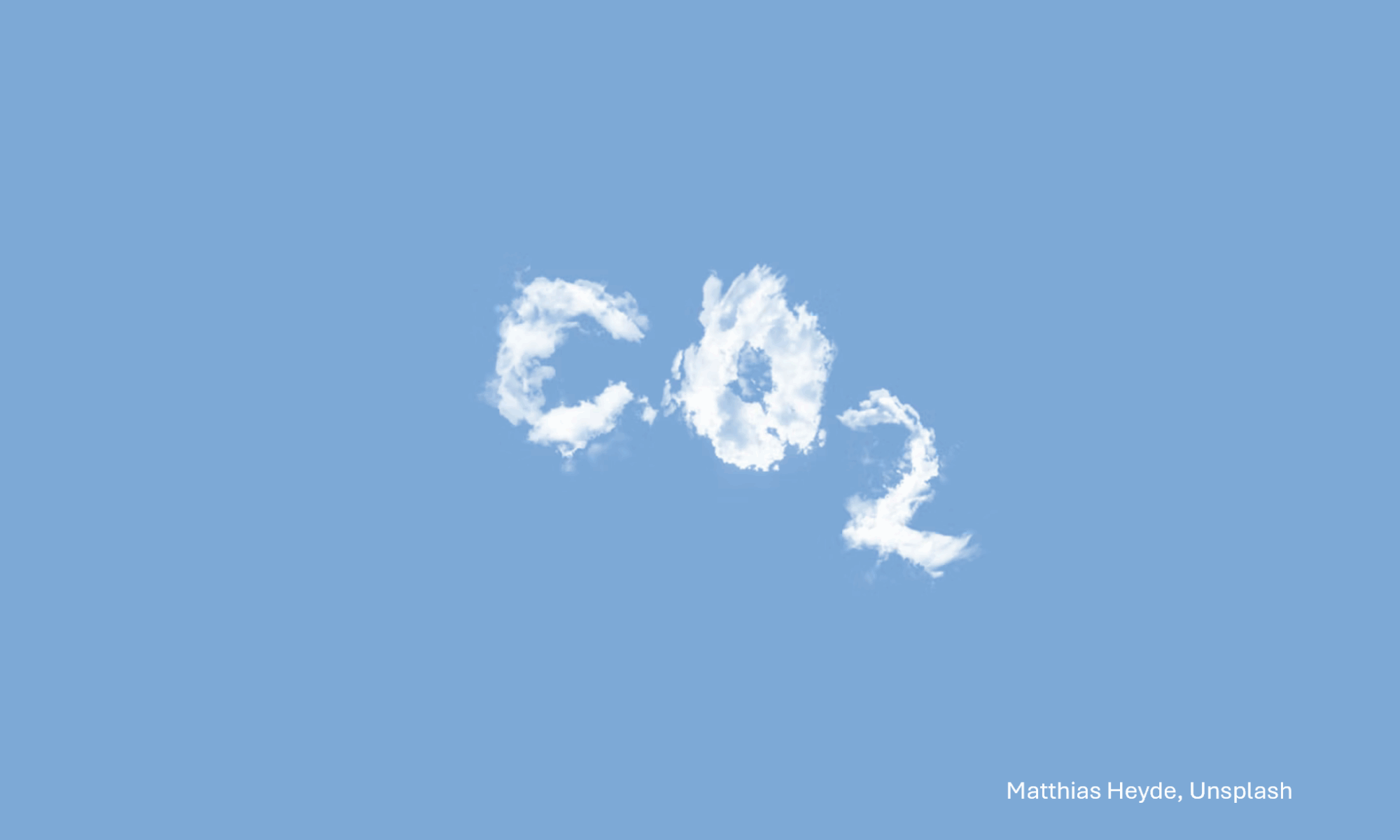„Erst kommt das Fressen, dann die Moral.“ (Bertolt Brecht)
„Man kann einen Teil des Volkes die ganze Zeit täuschen und das ganze Volk einen Teil der Zeit. Aber man kann nicht das gesamte Volk die ganze Zeit täuschen.“ (Abraham Lincoln)
Der Klimawandel ist eine große Herausforderung. Von der „grünen“ Euphorie, ihn wirksam zu bekämpfen, ist wenig geblieben. Die öffentliche Diskussion über das „Klima“ hat sich verändert. Die Bürger fürchten weniger den Klimawandel als den wirtschaftlichen Niedergang. Der gegenwärtigen Klimapolitik stellen sie kein gutes Zeugnis aus. Er bewirke für das weltweite Klima (fast) nichts, beschleunige aber den Prozess der nationalen De-Industrialisierung. Der Preis für das fast Nichts sei zu hoch. In der Klimapolitik sei eine Wende dringend notwendig. Damit steht auch das europäische Emissionshandelssystem, das Herzstück der Klimapolitik in der EU, auf dem Prüfstand. Ein Teil der (energieintensiven) Industrie läuft Sturm dagegen. Sie fordert lautstark, den europäischen Zertifikatehandel abzuschaffen.
Klimapolitik in der Kritik
Die Politik versucht seit langem, den Klimawandel zu verlangsamen. Sie setzt auf viele Mittel, mehr planwirtschaftliche, weniger marktwirtschaftliche. Der Emissionshandel, ein marktwirtschaftliches Instrument, ist der Goldstandard der Klimapolitik. Er ist das wirksamste und kostengünstigste Mittel der Klimapolitik. Die EU hat vor 20 Jahren weltweit zuerst ein Emissionshandelssystem (ETS) eingeführt. Er gilt allerdings bisher nur für einige Sektoren, wie Industrie, Strom, Wärme und den Luft- und Seeverkehr. Ab 2028 sollen weitere Sektoren, wie Gebäude und Verkehr, mit dazu kommen (ETS2). Der Europäische Emissionshandel war relativ erfolgreich. Die Sektoren, für die er galt, haben über 50 % weniger C02 emittiert als andere Sektoren.
Trotzdem ist auch der Emissionshandel unter Druck. Er leidet unter der wachsenden Kritik an der Klimapolitik. Die Bürger waren lange der Meinung, Klimapolitik kostet nicht mehr als „1 Kugel Eis“. Nun wird ihnen klar, Klimapolitik gibt es nicht umsonst. Sie ist teuer und fordert individuelle Opfer. Die „grüne“ Euphorie ist verflogen, Klimapolitik wird zunehmend kritisch gesehen. Plan- und marktwirtschaftliche Mittel haben unterschiedliche Ertrags-Kosten-Relationen. Planwirtschaftliche Klimapolitik tut nicht nur wenig für das weltweite Klima, es ist auch sündhaft teuer. Das ETS hat zwar eine günstigere Ertrags-Kosten-Relation. Es ist das effizienteste Mittel der Klimapolitik. Trotzdem gerät auch es immer mehr unter öffentlichen Druck.
Konstruktionsfehler des ETS
Das europäische Emissionshandelssystem hat zwei Konstruktionsfehler, einen allokativen und einen distributiven. Der allokative ist gravierend und nur schwer zu beheben, der distributive ist gewichtig, lässt sich aber korrigieren. Das ETS bringt energieintensive Unternehmen im internationalen Wettbewerb in Schwierigkeiten. Die C02-Preise belasten europäische Unternehmen. Diese Lasten sind für ausländische Unternehmen geringer, wenn in ihrem Heimatland die Klimapolitik weniger restriktiv und kostenträchtig ist. Das ETS stellt europäische Unternehmen internationalen Wettbewerb schlechter als nicht-europäische. Dieses Missverhältnis könnte sich noch verschärfen, weil die C02-Preise weiter steigen und das ETS2 in Kraft tritt.
Die EU hat auf diesen Konstruktionsfehler reagiert. 2026 soll ein Grenzausgleichsmechanismus in Kraft treten. Weniger klimapolitisch belastete ausländische Unternehmen müssen zahlen, wenn sie ihre Produkte in der EU verkaufen wollen. Damit soll der klimapolitisch bedingte Wettbewerbsnachteil europäischer Unternehmen ausgeglichen werden. Der „Zoll“ auf nicht-europäische Importe soll bisher nur für Vorprodukte gelten. Es ist eine „mission impossible“, zumindest aber eine bürokratische Schwerstarbeit, den C02-Gehalt importierter Vorleistungen zu ermitteln. Eine Beschränkung auf Vorprodukte hat den weiteren Nachteil, dass die Produktion ins emissionshandelsfreiere Ausland verlagert wird (Clemens Fuest). Dehnt man den Grenzausgleich auf Fertigprodukte aus, erhöht man die Gefahr eines Handelskrieges. Donald Trump hat schon damit gedroht.
Der Grenzausgleichsmechanismus versucht, die klimapolitikbedingten Wettbewerbsnachteile europäischer Unternehmen gegenüber der nicht-europäischen Konkurrenz auf den europäischen Märkten in den Griff zu bekommen. Gelingen wird das eher nicht. Er tut aber nichts, die Wettbewerbsnachteile klimapolitisch stärker belasteter europäischer Unternehmen auf Drittmärkten zu korrigieren. Dazu wäre es notwendig, die exportierenden, C02-belasteten europäischen Unternehmen zu subventionieren. Das wäre allerdings nicht nur nicht WTO-konform und würde Handelskonflikte verstärken. Es würde auch die Anreize der exportierenden Unternehmen, C02 einzusparen, vollständig eliminieren. Dem Klimaziel wäre damit ein Bärendienst erwiesen.
Klima-Wettbewerbsfähigkeits-Dilemma
Es werden drei Wege diskutiert, das Dilemma zu entschärfen. In der ersten Variante sollen die Klimaziele erreicht werden. Das ETS als effizientes (marktwirtschaftliches) Instrument der Klimapolitik soll erhalten bleiben. C02-Zertifikate sollen so lange kostenlos zuzuteilen, bis ein fairer internationaler Wettbewerb erreicht ist. Nichts Neues: Das macht die EU-Kommission bisher schon. Die Nachteile einer solchen Politik: Die Klimaziele werden real verringert. Unternehmen werden längerfristig subventioniert, da eine Lösung des internationalen Kooperations-Problems nicht in Sicht ist. Die Anreize der Unternehmen, C02 einzusparen, gehen zurück. Der Politik gefällt eine solche Lösung nicht, weil sie Einnahmen aus C02-Zertifikaten verlieren.
In einer zweiten Variante sollen zwar die Klimaziele nicht aufgegeben werden, wohl aber das europäische Emissionshandelssystem abgeschafft werden. Das wäre ein Rückfall in ineffizientere Formen der Klimapolitik. Die Klimaziele würden wieder stärker über Regulierungen und Subventionen verfolgt. „Wer fordert, den Zertifikatehandel aufzugeben, aber die Klimaziele einhalten will, sagt indirekt, dass er dazu bereit ist, höhere Steuern zu zahlen, um die Subventionen zu finanzieren“ (Achim Wambach). Aus diesem Dilemma kann auch das Sondervermögen nicht helfen. Eine solche Klimapolitik würde den Weg für (noch) mehr Ordnungsrecht ebnen. Alles in allem: Mehr Planwirtschaft und weniger Marktwirtschaft in der Klimapolitik.
In einer dritten Variante wird gefordert, die Klimaziele zu modifizieren. In einer extremen Version sollen die Klimaziele aufgegeben, in einer moderateren Variante sollen sie nur zeitlich verschoben werden. Die EU hat gerade entschieden, formal an den Klimazielen festzuhalten. Sie erlaubt aber die Anrechnung von umstrittenen Klimazertifikaten in Drittländern (hier) und senkt die Etappenziele auf dem Weg zu den Klimazielen. Eine andere Version haben die Wirtschaftsforschungsinstitute in ihrem Herbstgutachten vorgeschlagen. Die europäische Klimapolitik solle sich an der weniger strengen internationalen Klimapolitik orientieren. Sie schlagen „reziproke“ Klimaziele vor. Kurz und gut: Niedrigere Klimaziele der EU verringern die klimapolitischen Nachteile europäischer Unternehmen im intensiven internationalen Wettbewerb.
ETS und Ungleichheit
Die europäische Klimapolitik über das ETS verbessert die allokative Effizienz, ist aber nicht frei von distributiven Fehlentwicklungen. (Steigende) C02-Preise verursachen Kosten, die von den Nachfragern der durch C02-Preise belasteten Güter getragen werden müssen. Das ETS1 (Industrie, Strom, Wärme, Luft- und Seeverkehr) macht die Güter dieser Sektoren teurer. Mit dem ETS2 (Gebäude, Verkehr) erhöhen sich Mieten und der Unterhalt von Autos. Haushalte mit niedrigem Einkommen werden stärker belastet als Haushalte, die über ein höheres Einkommen verfügen. Sie geben einen größeren Teil ihres Einkommens für energieintensive Güter aus. Unterschiede in der Belastung treten aber auch zwischen Stadt und Land auf. Individuen in ländlichen Regionen werden vor allem auch deshalb stärker belastet, weil der Weg zur Arbeit länger ist.
Es gibt distributive Risiken des Zertifikatehandels. Es ist aber möglich, sie zu korrigieren. Die finanziellen Erträge, die aus dem Emissionshandel erzielt werden, könnten sozial motiviert umverteilt werden. Ein Vorschlag ist das Klimageld, das als Pro-Kopf-Variante untere Einkommen entlastet und oberen belastet. Das wäre allerdings Verteilungspolitik mit der Schrottflinte. Eine zieladäquatere Variante wären gezielte finanzielle Hilfen für bedürftige Haushalte. Wie das Wohngeld würde in der Grundsicherung ein Klimageld für einkommensschwache Haushalte gezahlt, in Abhängigkeit von deren Bedürftigkeit. Eine Klimapolitik über den Emissionshandel wäre effizient und bei bedürftigkeitsgeprüfter Rückgabe der Einnahmen auch gerecht.
Fazit
Die Klimapolitik ist weltweit unter Druck. Auch das europäische Emissionshandelssystem ist in der Kritik. Dem weltweiten Klima hilft es (fast) nichts, den industriellen Niedergang in der EU beschleunigt es. Das ETS hat allokative und distributive Konstruktionsfehler. Das eigentliche Problem ist aber nicht der (unvollkommene) Zertifikatehandel. Es fehlt an weltweiter klimapolitischer Kooperation. Die ist aber notwendig, damit der europäische Emissionshandel das weltweite Klima positiv beeinflussen kann, ohne die eigene nationale Wirtschaft zu zerstören. Allerdings: Das ETS kann das weltweite Kooperations-Problem nicht lösen. Europa steckt in einer selbstzerstörerischen Klima-Falle. Wenn es sich wirtschaftlich nicht vollends ruinieren will, muss es bei den Klimazielen abspecken. Macht das die Politik nicht bald, werden es die Wähler tun.
Hinweis: Der Beitrag profitiert von dem ausführlichen Podcast-Gespräch, das ich mit Achim Wambach geführt habe.
Podcast zum Thema:
Emissionshandel unter Druck. Steht die (marktwirtschaftliche) Klimapolitik auf der Kippe?
Prof. (em.) Dr. Norbert Berthold (JMU) im Gespräch mit Prof. Achim Wambach, PhD (ZEW)
Blog-Beiträge zum Thema:
Joachim Weimann (OVGU, 2025): Beim Klima nichts Neues
Reint E. Gropp und Oliver Holtemöller (IWH, 2024): Sechs Punkte für mehr Effizienz
Video zum Thema:
Joachim Weimann (OVGU, 2021): Was ist gute Klimapolitik?
Blog-Beiträge der Serie „Europäischer Emissionshandel in der Kritik“
Vincent Stamer (CBK, 2025): Verschärfter C02-Preis
David Stadelmann (UBT, 2025): Renten, Regulierung, Realitätsverlust. Klimapolitik unter Druck
Achim Wambach (ZEW, 2025): Weiter freie Zertifikate
Jan Schnellenbach (BTU, 2025): Die Gefahren des Kampfes gegen den Emissionshandel
Norbert Berthold (JMU, 2025): Klima im Wandel: Wende in der (europäischen) Klimapolitik?
- De-Industrialisierung in Deutschland
Strukturwandel, Politikversagen, Rostgürtel - 13. Februar 2026 - Wie „gerecht“ ist das denn?
Einkommen, Demographie, Vermögen - 23. Januar 2026 - Vermögensungleichheit – Ein non-issue?
Empirie, Ursachen, Handlungsbedarf - 30. Dezember 2025