Politikverdrossenheit ist zu einem guten Teil darauf zurückzuführen, dass der Staat seinen Bürgern nur „One size fits all“-Lösungen anbieten kann. Die Bürger müssen mit dem leben, was die gewählte Regierung beschließt. Sie müssen Kompromisse eingehen, die sie von privaten Konsumentscheidungen kaum noch kennen – denn hier erhalten sie maßgeschneiderte Lösungen. Es liegt daher nahe, dass die Politik bei möglichst vielen Themen keine kollektiven Lösungen anstreben, sondern sich auf die klassischen öffentlichen Güter konzentrieren sollte. Zudem wären Volksentscheide geeignet, die Präferenzen der Bürger besser zu berücksichtigen als es gegenwärtig der Fall ist.
Zufrieden und unzufrieden zugleich – so präsentieren sich die Deutschen zu Beginn des Jahres 2024. Zumindest lässt sich der „ARD DeutschlandTREND Januar 2024“ in diesem Sinne interpretieren. 55 % der Befragten glauben, dass 2024 für sie persönlich ein eher gutes Jahr wird (32 % erwarten für sich persönlich eher ein schlechtes Jahr). Deutlich anders sieht es aus, wenn es um die Gesellschaft als Ganzes geht: „Finden Sie, dass die Verhältnisse derzeit in Deutschland eher Anlass zur Zuversicht oder eher Anlass zu Beunruhigung geben?“ Bei dieser Frage sehen 83 % der Befragten Anlass zur Beunruhigung, nur 13 % Anlass zur Zuversicht.
Das Ergebnis zeigt eine erhebliche Kluft zwischen Privatleben und öffentlichem Leben. Damit bestätigt der DeutschlandTREND einen Befund, zu dem vorher bereits andere Studien gekommen waren. So diagnostizierte das Rheingold Institut im Sommer letzten Jahres als Ergebnis einer tiefenpsychologischen Studie eine große Diskrepanz zwischen der persönlichen Zuversicht der Deutschen auf der einen Seite und dem Vertrauen in Politik, Wirtschaft und Gesellschaft auf der anderen Seite.
Auch die anekdotische Evidenz trägt zu diesem Bild bei. Wer kennt sie nicht, die Diskussionen im privaten Umfeld, bei dem über die Zustände in Politik und Gesellschaft geschimpft wird, bevor kurz vor dem Ende der Diskussion oft die salomonische Einsicht kommt: „Aber uns persönlich geht es ja noch gut.“
Das alles ist keine Momentaufnahme. Das Spannungsverhältnis zwischen individueller Zufriedenheit und gesellschaftlicher Unzufriedenheit gibt es schon länger. Doch es hat sich offenkundig deutlich verstärkt in den letzten Jahren. Aus ökonomischer Sicht lässt sich das Spannungsverhältnis leicht erklären. Dafür muss man sich lediglich den Unterschied zwischen privaten und öffentlichen Gütern vergegenwärtigen.
Private Güter werden über Märkte bereitgestellt – und zwar in der Qualität und in dem Umfang, wie es die Konsumenten wünschen. So kann sich jeder Bürger im Rahmen seiner finanziellen Möglichkeiten genau die Waren und Dienstleistungen kaufen, die seinen persönlichen Vorstellungen entsprechen. Seine individuellen Bedürfnisse werden optimal erfüllt – immer öfter sogar maßgeschneidert.
Bei öffentlichen Gütern bzw. Kollektivgütern stellt sich die Lage völlig anders dar. Hier müssen die Bürger mit Einheitsware leben. Öffentliche Güter können über Märkte nicht oder nicht in zufriedenstellender Weise bereitgestellt werden. Die Bereitstellung öffentlicher Güter erfordert ein in der Praxis meist unerreichbar hohes Maß an Kooperation der Beteiligten.
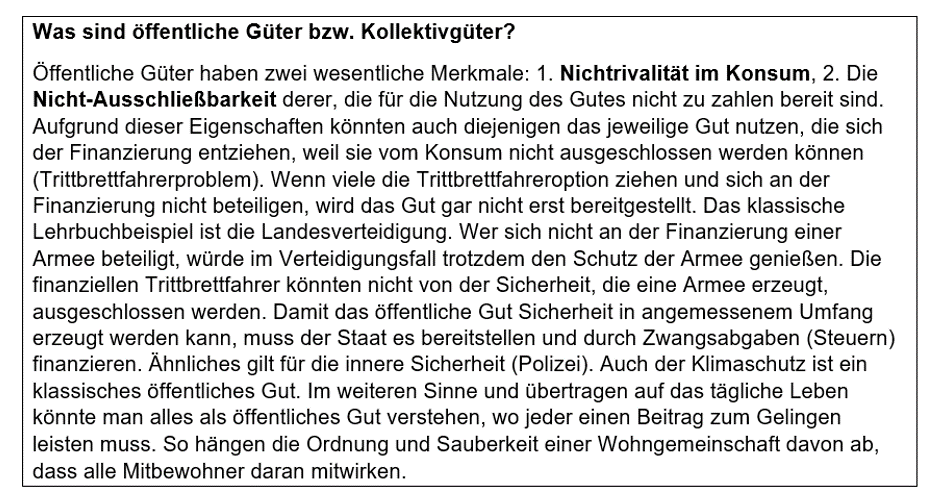
Was sind öffentliche Güter bzw. Kollektivgüter?
Öffentliche Güter haben zwei wesentliche Merkmale: 1. Nichtrivalität im Konsum, 2. Die Nicht-Ausschließbarkeit derer, die für die Nutzung des Gutes nicht zu zahlen bereit sind. Aufgrund dieser Eigenschaften könnten auch diejenigen das jeweilige Gut nutzen, die sich der Finanzierung entziehen, weil sie vom Konsum nicht ausgeschlossen werden können (Trittbrettfahrerproblem). Wenn viele die Trittbrettfahreroption ziehen und sich an der Finanzierung nicht beteiligen, wird das Gut gar nicht erst bereitgestellt. Das klassische Lehrbuchbeispiel ist die Landesverteidigung. Wer sich nicht an der Finanzierung einer Armee beteiligt, würde im Verteidigungsfall trotzdem den Schutz der Armee genießen. Die finanziellen Trittbrettfahrer könnten nicht von der Sicherheit, die eine Armee erzeugt, ausgeschlossen werden. Damit das öffentliche Gut Sicherheit in angemessenem Umfang erzeugt werden kann, muss der Staat es bereitstellen und durch Zwangsabgaben (Steuern) finanzieren. Ähnliches gilt für die innere Sicherheit (Polizei). Auch der Klimaschutz ist ein klassisches öffentliches Gut. Im weiteren Sinne und übertragen auf das tägliche Leben könnte man alles als öffentliches Gut verstehen, wo jeder einen Beitrag zum Gelingen leisten muss. So hängen die Ordnung und Sauberkeit einer Wohngemeinschaft davon ab, dass alle Mitbewohner daran mitwirken.
Zufriedenheit herrscht also vor allem da, wo es um private Güter geht. Denn hier kann sich jeder Bürger sein Leben im Rahmen seiner Möglichkeiten exakt so gestalten, wie es seinen eigenen Vorstellungen bzw. Präferenzen entspricht. Anders formuliert: Er bekommt genau das, was er bestellt.
Im Unterschied dazu ist die Unzufriedenheit mit dem Angebot öffentlicher Güter vorprogrammiert. Deren Bereitstellung wird im Rahmen von Wahlen an den Staat delegiert. Wahlen sind Mehrheitsentscheide. Diese Mehrheitsentscheide führen zwangsläufig zu Unzufriedenheit bei den allermeisten Bürgern, weil praktisch niemand genau das bekommt, was seinen Vorstellungen entspricht: Für manche Bürger ist die Klima- und Umweltschutzpolitik nicht konsequent genug, für andere ist sie schon zu weitreichend. Für manche tut die Politik zu wenig für die innere Sicherheit, andere wittern gleichzeitig schon einen Polizeistaat. Für manche lässt der Staat den Bürgern zu viel Freiheit, andere wünschen sich mehr Freiheit. Manche haben die Corona-Politik als zu rigide empfunden, andere hätten sich ein noch konsequenteres Vorgehen der Politik gewünscht („Zero Covid“). Die Liste ließe sich beliebig verlängern.
Entscheidend ist, dass die Politik keine maßgeschneiderten Lösungen anbieten kann, sondern nur „one size fits all“. Die Bürger müssen mit dem leben, was die gewählte Regierung beschließt. Sie müssen Kompromisse eingehen, die sie von privaten Konsumentscheidungen kaum noch kennen. Damit geht eine Unzufriedenheit bei den Bürgern einher, die sich nicht völlig beseitigen lässt – egal wie gut eine Regierung auch sein mag.
Nun könnte man mit dem Wagnerschen Gesetz argumentieren, dass staatliche Leistungen bzw. öffentliche Güter superiore Güter sind, bei denen die Nachfrage mit höheren Einkommen steigt. Reichere Gesellschaften würden demnach mehr öffentliche Güter nachfragen. Darin steckt ein Stück Wahrheit. Wer seine Grundbedürfnisse bereits gedeckt hat, interessiert sich zunehmend auch für Dinge, die er sich früher nicht leisten konnte oder die ihm nicht wichtig genug erschienen. Ein gutes Beispiel ist der Wunsch nach Umweltschutz, der mit steigendem materiellem Wohlstand zunimmt. Gleichwohl können daraus zusätzliche gesellschaftliche Spannungen entstehen, weil die Einkommen und Vermögen innerhalb der reicheren Volkswirtschaften ungleich verteilt sind und damit auch die Fähigkeit, die finanziellen Lasten des verstärkten Umweltschutzes zu schultern. Für die reicheren Bürger mag preistreibender Umweltschutz wünschenswert und finanzierbar sein, für die ärmeren Bürger schränkt es die bisherigen Lebensgewohnheiten potentiell deutlich ein.
Mit dem Wagnerschen Gesetz ließe sich nun vermuten, dass die Unzufriedenheit mit steigendem Wohlstand zwangsläufig zunehmen müsste, weil die Nachfrage nach öffentlichen Gütern steigt und die skizzierten Zusammenhänge immer mehr um sich greifen. Doch diese Vermutung wäre voreilig und undifferenziert. Es gibt nämlich erhebliche Spielräume, was die Qualität der staatlichen Aufgabenerfüllung angeht.
Beispiel Klimapolitik: Die Politik kann auf kosteneffiziente Maßnahmen setzen (Emissionszertifikate) oder auf teures Mikromanagement (z.B. Heizungsverbote), um ein gegebenes Klimaschutzziel zu erreichen. Beide Maßnahmen sind bei der Bevölkerung unbeliebt, weil sie Kosten verursachen, denen kein direkter Nutzen gegenübersteht. Die Unzufriedenheit hängt aber maßgeblich davon ab, wie hoch die Kosten ausfallen. Der Staat hat also einen erheblichen Gestaltungsspielraum und damit auch maßgeblichen Einfluss darauf, wie hoch die (Un-) Zufriedenheit der Bürger ausfällt.
Beispiel Verteidigungspolitik: Wenn zu Beginn des russischen Überfalls auf die Ukraine der Inspekteur des Heeres, General Alfons Mais, via LinkedIn verkündet, die Bundeswehr stehe mehr oder minder blank da, zeigt das ein eklatantes Staatsversagen bei der Bereitstellung des klassischsten aller klassischen Kollektivgüter. Wenn dann auch noch der Verteidigungsetat mit 11,62 % der zweitgrößte Posten im Bundeshaushalt 2022 war, ist Unzufriedenheit der Bürger nur allzu verständlich. Denn mit der gegebenen Finanzausstattung hätte die Bundeswehr offenkundig schlagkräftiger aufgestellt sein können.
Die Politik hat es also in der eigenen Hand, die Bürger mit einer geradlinigen Politik bei der Bereitstellung öffentlicher Güter tendenziell zufrieden zu machen oder andernfalls frustriert zurückzulassen.
Lösungsansätze
Darüber hinaus gibt es mindestens drei Ansätze, die systemimmanente Unzufriedenheit im Bereich der Kollektivgüter zu reduzieren.
- Bürgerpräferenzen vereinheitlichen. Je homogener die Bevölkerung, je einheitlicher die Präferenzen der Bürger und je einheitlicher der Kenntnisstand der Bevölkerung, desto geringer ist das Konfliktpotential bei Kollektivgütern. Wenn alle das gleiche wollen, fällt es leicht, sich auf Art und Umfang der Kollektivgüter zu einigen. Doch die Menschen sind unterschiedlich. Und sie lassen sich als Erwachsene ungern umerziehen. Die vergangenen Jahre haben gezeigt, dass die Versuche, die Menschen mittels Framing, Nudging etc. gesellschaftlich in eine ähnliche Richtung zu lenken, vielfach scheitern. Sie tragen nicht zum gesellschaftlichen Frieden, sondern oft zu gesellschaftlichen Spannungen bei. Hinzu kommt: Der weit verbreitete übergeordnete politische Zeitgeist, gesellschaftliche Vielfalt zu fördern, wirkt den Bestrebungen der Vereinheitlichung entgegen. Auch ungesteuerte Zuwanderung spannt den Präferenzfächer weiter auf. Die für das Zusammenleben und das Funktionieren einer Gesellschaft nötigen Gemeinsamkeiten wachsen über sehr lange Zeiträume, manchmal über Generationen. Sie lassen sich nicht verordnen. Insofern ist die Vereinheitlichung der Bürgerpräferenzen in weiten Teilen eine Scheinlösung – in jedem Fall ist sie nur sehr langfristig eine denkbare Lösung.
- Kollektivgüter eng definieren. Was gilt als Kollektivgut? Kollektivgüter lassen sich in einem engen und in einem weiten Sinn definieren. Daraus ergibt sich, ob der Staat für viele Bereiche des öffentlichen Lebens zuständig sein soll oder ob er sich nur auf seine klassischen Kernaufgaben konzentriert (innere und äußere Sicherheit, Setzen des Rechtsrahmens, Klimaschutz u.a.). Wenn der Staat wie oben skizziert schon bei der Bereitstellung der klassischen Kollektivgüter seine Schwierigkeiten hat, spricht viel dafür, sich in anderen, weniger elementaren Bereichen zurückzuhalten. Unglücklicherweise zeigt sich seit einiger Zeit ein anderer Trend: Mit Verweis auf das sogenannte Gemeinwohl werden für immer mehr Bereiche kollektive Lösungen gefordert. Überall werden externe Effekte gewittert, die es zu beseitigen gilt. Der Markt wird immer seltener als Instrument für umfassenden Interessenausgleich gesehen. Dabei ist offensichtlich, dass der Staat beim Quantifizieren und Internalisieren der externen Effekte schnell an Grenzen stößt. Eine Verbesserung der gesamtwirtschaftlichen Wohlfahrt wird dadurch zur Glückssache. Oft werden Kollektivismus-Initiativen von Interessen- und Lobbygruppen gesteuert, die vorgeben, im Interesse des Gemeinwohls zu agieren, letztlich aber nur ihre Partikularinteressen bedient sehen wollen. Auch hier kommt es zu erheblichen Ambivalenzen: Die Forderungen nach Kollektivlösungen kommen verstärkt aus den Milieus, die ansonsten gern Rücksicht auf jede Mikro-Befindlichkeit eines jeden Individuums einfordern („Gesellschaft der Singularitäten“). Fazit: Erfolgversprechender erscheint, Kollektivgüter enger auszulegen und so viele Anliegen wie möglich auf persönlicher Ebene durch gegenseitige Rücksichtnahme zu regeln.
- Direkte Demokratie: Die Bürger wählen eine Partei, von deren Programm bzw. Wahlversprechen sie die größtmögliche Erfüllung ihrer eigenen Interessen erwarten. Jede Partei bietet aber ein ganzes Politikbündel an, mit dem deren Wähler nur zu einem Teil übereinstimmen. In einzelnen Punkten mögen andere Parteien bessere Konzepte anbieten, die der Wähler aber nicht wählen kann, weil er sich für das Gesamtpaket einer Partei entscheiden muss. Damit ist bereits der Grundstein dafür gelegt, dass der Wähler mit dem Gesamtergebnis der Politik unzufrieden ist. Hinzu kommt: Es gibt im Regelfall Regierungskoalitionen, die untereinander erhebliche Kompromisse schließen müssen. So kommen Politikergebnisse zustande, die immer seltener den originären Präferenzen der Parteien und derer Wähler entsprechen. Die Unzufriedenheit wächst. Wie lassen sich nun die Ergebnisse der Politik wieder näher an die Wünsche der Wähler bringen? Eine Möglichkeit wäre, mehr direkte Demokratie zu wagen, also Volksentscheide über konkrete politische Maßnahmen zuzulassen. Damit könnten die Bürger ihre Präferenzen direkt und ohne Umweg über die Wahl von Parteien bekunden. Ein Standardargument gegen Volksentscheide lautet, dass den Bürgern die Kenntnisse fehlen, um über komplexe Fragen zu entscheiden. Doch dieses Argument trägt nur bedingt. Erstens könnte man nur die weniger komplexen Themen, bei denen es eher um weltanschauliche als um komplexe Fachfragen geht, direktdemokratisch entscheiden lassen. Zweitens steht die These, die Politik verfüge über die bessere Expertise und komme deswegen zu besseren Ergebnissen, auf wackeligen Beinen. In der amtierenden Bundesregierung gibt es mit den Grünen und den Liberalen zwei Parteien, die bei den Antworten auf viele politische Fragen meilenweit auseinanderliegen, obwohl sie beide über ähnlich qualifizierte Beratergremien verfügen. Damit zeigt sich, dass auch bei Entscheidungen von hoher politischer Tragweite der Zugriff auf höchstqualifizierte Experten oft nicht zu einer eindeutigen Handlungsempfehlung führt. Die Schweiz hat gute Erfahrungen mit Volksentscheiden gemacht – auch deshalb, weil sich die Bürger über die abzustimmenden Themen besser informieren, als wenn sie alle Entscheidungen an Politiker delegieren.
- Gastbeitrag
Volkswirtschaftliche Folgen der KI-Revolution
Was wäre wenn…? - 11. März 2026 - (Kurz)Podcast
Eurobonds: Chancen und Risiken - 19. Februar 2026 - Gastbeitrag
Nach den Grönland-Zöllen
Fokus auf die FED - 27. Januar 2026

