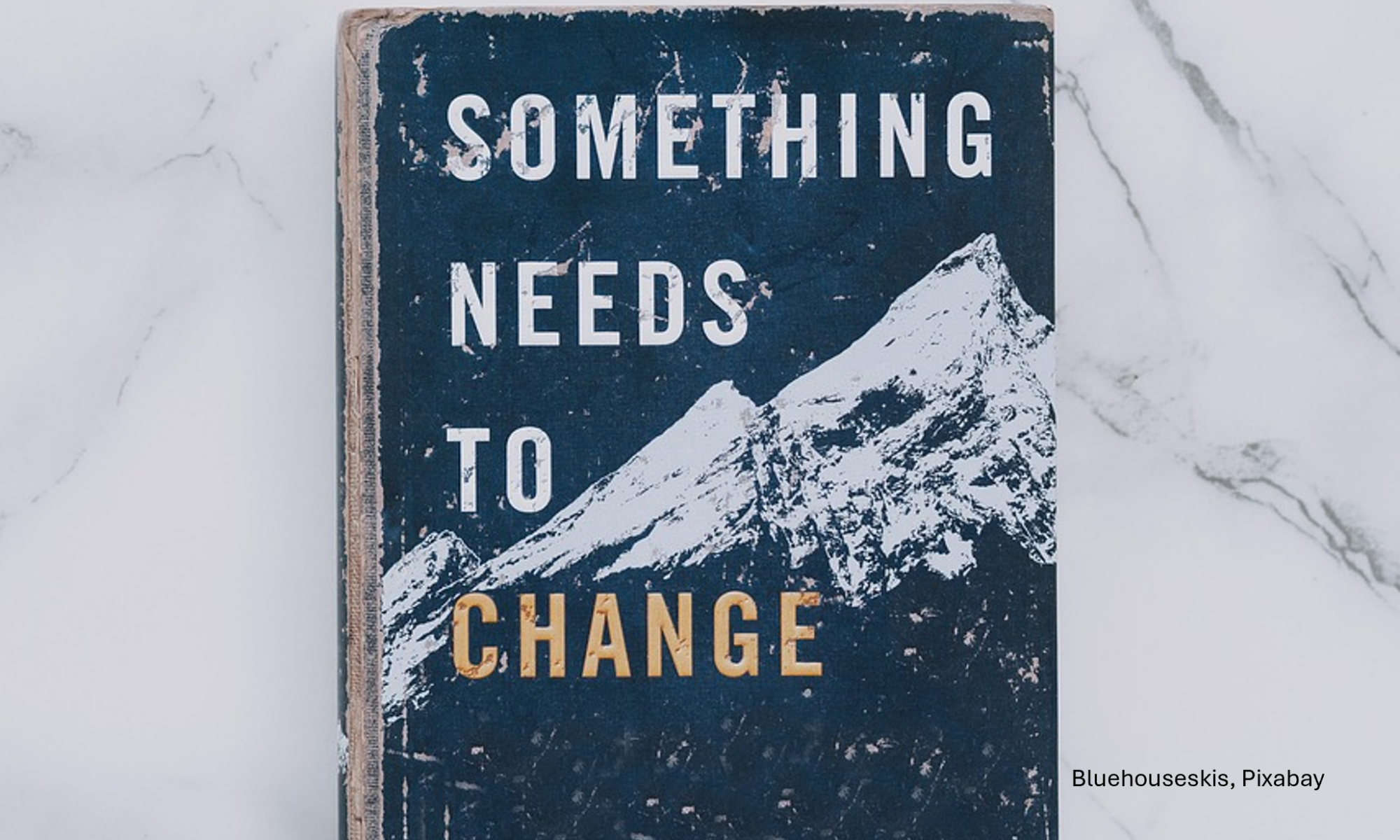Die deutsche Wirtschaft befindet sich in einer anhaltenden Schwächephase, die wesentlich durch tieferliegende strukturelle Probleme begründet ist. Seit langem absehbar sind insbesondere die Auswirkungen des demographischen Wandels auf das Arbeitskräfteangebot sowie die sozialen Sicherungssysteme. Auch die hohen Bürokratielasten, die schwerfälligen Verwaltungsprozesse, die zum Teil dysfunktionale föderale Struktur sowie die zunehmend verfallende Infrastruktur sind keine neuen Phänomene. Zusätzlich zu bewältigen sind die grüne und digitale Transformation sowie die Herausforderungen, die sich durch die neue geoökonomische Lage ergeben. Die wirtschafts- und finanzpolitischen Herausforderungen für die neue Bundesregierung sind also groß: Grundlegende Strukturreformen, die das Wachstumspotenzial der deutschen Wirtschaft stärken sowie die Sozialversicherungen zukunftsfest machen, sind genauso nötig wie umfangreiche Investitionen in die Infrastruktur und die Klimaneutralität. Zudem gilt es, die Verteidigungsfähigkeit unseres Landes deutlich zu verbessern. Neben finanziellen Mitteln ist insbesondere eine marktwirtschaftlich orientierte Reformagenda notwendig, die die Innovationsfähigkeit der deutschen Wirtschaft stärkt, Arbeitskräfte mobilisiert und private Investitionen attraktiver macht. Zudem sind die Verwaltungsstrukturen und die föderale Ordnung so zu reformieren, dass der Staat seinen Aufgaben effizient nachkommen kann und die Bevölkerung wieder in seine Leistungsfähigkeit vertraut.
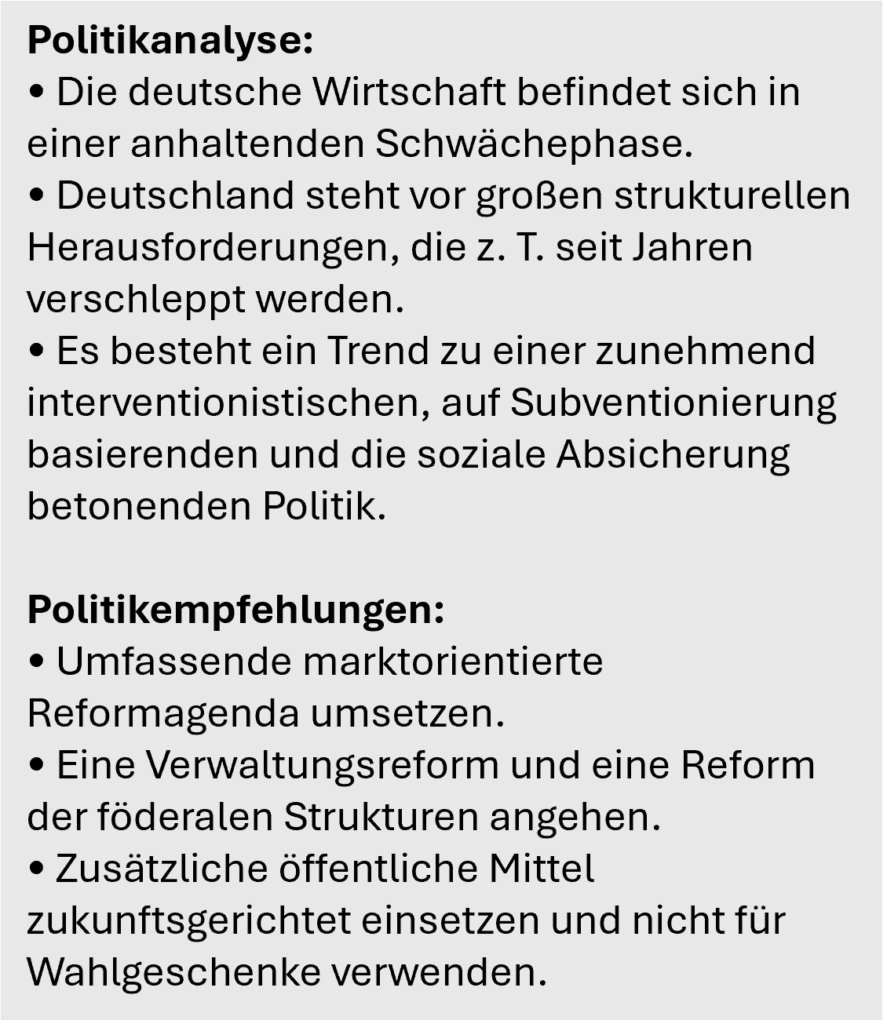
Die neue Bundesregierung tritt ihr Amt in Zeiten einer verfestigten Wachstumsschwäche der deutschen Wirtschaft an. Das Wachstumspotenzial wird für die kommenden Jahre auf lediglich 0,4 Prozent pro Jahr geschätzt. Anders als z. B. in Frankreich oder Großbritannien ist es in Deutschland nicht gelungen, nach der Corona-Pandemie auf den vorherigen Wachstumspfad zurückzukehren. Und das vor dem Hintergrund multipler Herausforderungen. Während der demographische Wandel bereits seit mehreren Jahrzehnten seine Schatten vorauswirft und es somit ausreichend Gelegenheit gab, sich auf die absehbare Dämpfung der Wachstumskräfte sowie die steigenden finanziellen Lasten für die sozialen Sicherungssysteme vorzubereiten, sind weitere Herausforderungen erst im Laufe des letzten Jahrzehnts entstanden. So gerät das auf industrieller Wertschöpfung basierende und exportorientiert deutsche Wirtschaftsmodell, durch geopolitische Spannungen, zunehmenden Handelskonflikte und neue Wettbewerber zunehmend unter Druck. Die neue geopolitische Lage erfordert es zudem, sich besser gegen Störungen von Liefer-, Innovations- und Wertschöpfungsketten zu wappnen und die Verteidigungsfähigkeit deutlich zu verbessern. Schließlich gilt es, bis 2045 die Trans-formation hin zur Klimaneutralität zu bewerkstelligen, ohne dabei den Wohlstand zu gefährden.
Angesichts dieser Herausforderungen und der schwierigen Mehrheitsverhältnisse in der neuen Legislaturperiode haben Bundestag und Bundesrat kurz vor Ende der Legislaturperiode noch beschlossen, Ausgaben für Verteidigung und Sicherheit künftig weitgehend von der Schuldenbremse auszunehmen, den Ländern eine Verschuldungsmöglichkeit im Rahmen der Schuldenbremse zu gewähren und ein neues Sondervermögen in Höhe von 500 Mrd. Euro über 12 Jahre zu schaffen, um zusätzliche Infrastruktur- und Klimaschutzinvestitionen zu finanzieren. Weitere finanzielle Mittel allein werden jedoch nicht ausreichen, um die Herausforderungen zu meistern. Solange die Strukturen und der politische Wille fehlen, um das Geld priorisiert auszugeben, und grundlegende Strukturreformen nicht umgesetzt werden, die unternehmerisches Handeln entfesseln und das Arbeitskräfteangebot erhöhen, besteht die Gefahr, dass die Mittel nicht zukunftsgerichtet ausgegeben werden oder lediglich inflationssteigernd wirken. Um die Probleme nicht noch weiter zu verschärfen und noch mehr Lasten auf künftige Generationen zu verschieben, ist zudem eine klare Priorisierung von Zielen und Maßnahmen sowie den damit verbundenen Ausgaben notwendig. Dazu gehört auch, den Fokus wieder stärker darauf zu legen, dass Wirtschaftsleistung und Lebensstandard eng verknüpft sind. Dies ist ein Fundament der Sozialen Marktwirtschaft, das jedoch im Diskurs um immer neue vermeintlich sozialpolitische Maßnahmen sowie lediglich Einzelinteressen bedienende Maßnahmen in Vergessenheit zu geraten droht.
Um unternehmerische Initiative und Risikobereitschaft zu fördern, sind Regulierungsanforderungen und bürokratische Vorgaben auf den Prüfstand zu stellen und abzubauen, die Steuer- und Abgabenlast zu vermindern und eine im Wesentlichen horizontale Innovations- und Industriepolitik zu verfolgen, die den notwendigen Strukturwandel fördert und nicht alte Strukturen zementiert. Eine effiziente öffentliche Verwaltung, die die Vorteile der Digitalisierung nutzt und sich als Dienstleister für Unternehmen und Bevölkerung versteht, könnte viel dazu beitragen, unternehmerisches Handeln zu befördern und das Vertrauen in Politik und Verwaltung zu stärken. In diesem Zusammenhang könnte auch eine Reform der föderalen Ordnung, die die Aufgabenverteilung und die Finanzierung zwischen Bund, Ländern und Kommunen neu ordnet, einen wichtigen Beitrag leisten.
Es ist höchste Zeit für zukunftsgerichtete Reformen – zu lange haben sich Politik, Wirtschaft und Bevölkerung in Deutschland auf den Erfolgen ausgeruht und offensichtliche Reformnotwendigkeiten ignoriert. Solche Reformen bringen zunächst auch Einschnitte bzw. Veränderung mit sich. Sie umzusetzen, erfordert daher einen starken politischen Willen und eine gute politische Kommunikation sowie die Bereitschaft der Bevölkerung, Veränderung zu akzeptieren und sich darauf einzustellen.
Hinweis: Dieser Policy Brief entstand auf Grundlage des ECONWATCH-Meetings „Höchste Zeit für Reformen: Was wirtschaftspolitisch in der neuen Legislaturperiode zu tun ist“ mit Prof. Dr. Dr. h.c. Christoph M. Schmidt (RWI Essen).
- Gastbeitrag
Mehr Wettbewerbsföderalismus wagen! - 8. Januar 2026 - Gastbeitrag
Das Ende des „kapitalistischen Friedens“
Was Europa jetzt tun sollte - 7. Dezember 2025 - Gastbeitrag
Protektionismus aktiv mit Freihandelsagenda begegnen! - 1. August 2025