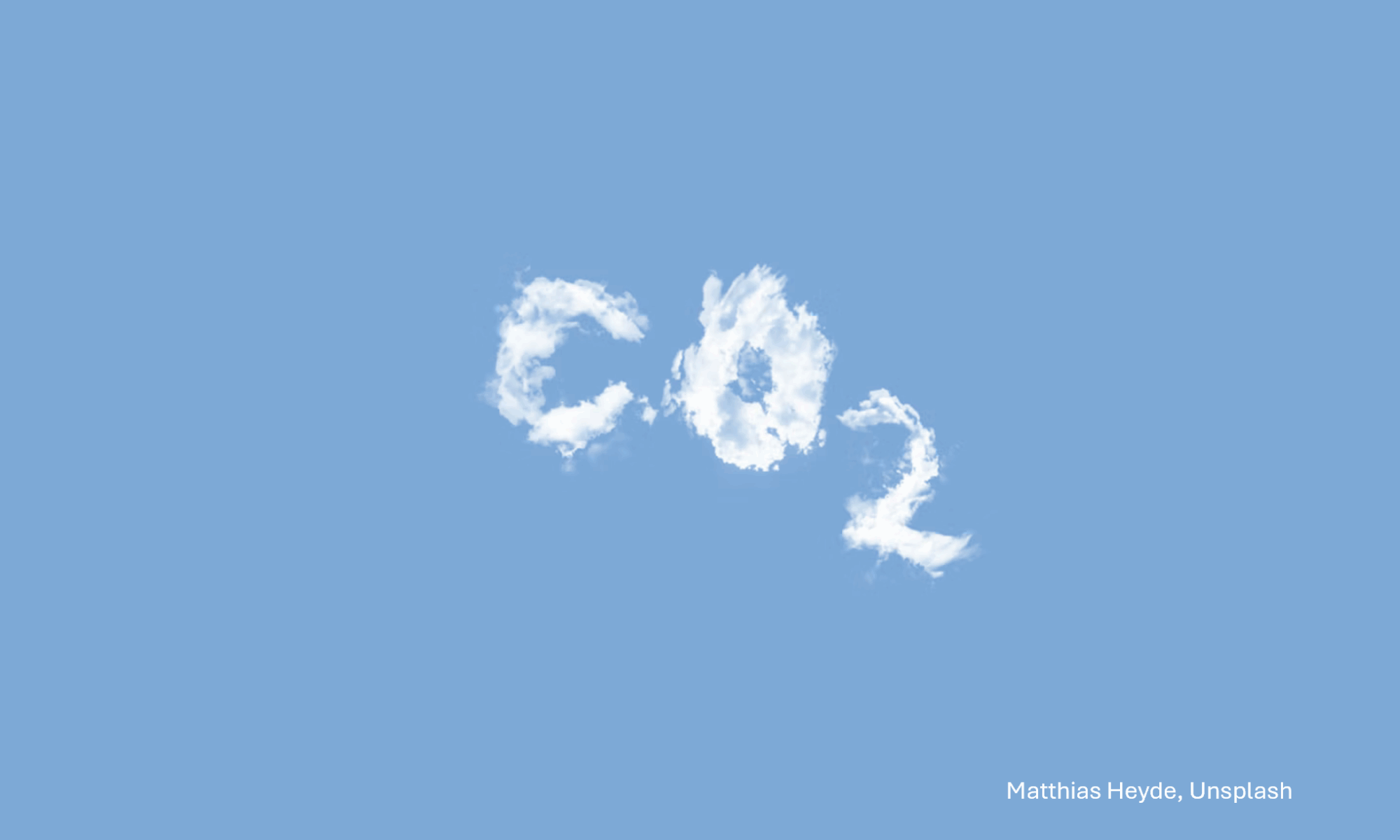Die Klimapolitik steht zunehmend unter Rechtfertigungsdruck. Ihre Kosten und Nutzen werden hinterfragt, die politische Zustimmung schwindet, und andere Prioritäten wie Altersvorsorge und Verteidigung drängen nach vorn. Entsprechend steht auch das europäische Emissionshandelssystem (EU-ETS) unter Druck. Einige Unternehmen und Politiker fordern sogar seine Abschaffung.
Mengensteuerung mit Rentengenerierung
Das EU-ETS ist ein marktorientiertes Mengensteuerungsinstrument. Es betrifft die Energieerzeugung, die energieintensive Industrie und den innereuropäischen Flugverkehr. Die Emissionsmenge wird begrenzt, Zertifikate werden gehandelt, ein Preis für CO2 entsteht. Dieses Preissignal erlaubt es Produzenten und Konsumenten, selbst zu entscheiden, wo sich Emissionsvermeidung lohnt, sodass Klimaschutz effizient erfolgt. Die Verknappung der Emissionsmenge erzeugt eine ökonomische Rente – ähnlich wie etwa bei Importquoten. Die Frage lautet, wer diese Rente abschöpft.
Da Unternehmen im Rahmen EU-ETS bislang einen erheblichen Teil der Zertifikate kostenlos erhielten und nur die fehlenden zukaufen mussten, stiegen zwar ihre Grenzkosten, nicht aber ihre Durchschnittskosten. Die höheren Grenzkosten können sie auf alle verkauften Einheiten über höhere Preise überwälzen, also auch auf solche, für die sie gratis Zertifikate erhalten haben. So war es möglich Zusatzrenditen bzw. Renten für Unternehmen zu generieren. Politökonomisch betrachtet war der ETS ein Art Kompromiss, der es erlaubte, dass die betroffenen Unternehmen das Emissionshandelssystem teilweise willkommen geheißen haben.
Nun läuft die Gratiszuteilung der Zertifikate langsam aus, auch weil mit dem CO2-Grenzausgleich (CBAM) ein neues Instrument eingeführt wird, das faktisch eine Art Klimazoll darstellt. Unternehmen fürchten nun schwindende Gewinne, da ihre Renten wegzufallen drohen.
Eine CO2-Steuer hätte die Renten von Anfang an anders verteilt. Sie setzt einen festen Preis pro Tonne CO2, anstatt Mengen zu rationieren. Die Einnahmen der CO2-Steuer und damit die Renten wären beim jeweiligen Nationalstaat angefallen.
Fehlende Kostenwahrheit
Der derzeitige Politik um den EU-ETS entspricht auch nicht vollständig dem Prinzip der Kostenwahrheit. Im Rahmen echter Kostenwahrheit müssten Einnahmen aus einer CO2-Bepreisung, sei es aus CO2-Steuer oder dem Verkauf von Zertifikaten im EU-ETS, an die Bürger zurückgeführt werden. So bliebe die Belastung der Bürger insgesamt konstant, während der CO2-Ausstoß sänke. Eine nationale CO2-Steuer erleichtert die Rückführung im Vergleich zum einem Europäischen Handelssystem, das relativ intransparenter ist und von organisierten Interessen mitgeprägt ist.
Zentral für Kostenwahrheit ist, dass durch eine CO2-Bepreisung jeglicher Art teure Subventionen, detaillierte Einzelregulierungen und technologiepolitische „Wetten“ wie etwa das EU-weite „Verbrenner-Verbot“ überflüssig werden. Denn das Klimaproblem wird über den CO2-Preis internalisiert. So erlaubt CO2-Bepreisung nach dem Konzept echter Kostenwahrheit eine vollständige Deregulierung im Klimabereich und setzt so wachstumsfördernde Impulse. Anders formuliert: Weitere Regulierungen neben einer CO2-Bepreisung sind wirkungslos und wohlfahrtsschädlich.
Globales Problem, nationale Lösung?
Der Ökonom und Nobelpreisträger William D. Nordhaus beziffert den global optimalen CO2-Preis derzeit auf etwa 60 US-Dollar pro Tonne mit einem steigenden Preispfad. Doch jede nationale CO2-Bepreisung hat klare Grenzen.
Klimaschutz ist ein globales öffentliches Gut. Alleingänge, ob national oder EU-weit, verursachen Kosten, bringen aber kaum Klimanutzen, wenn andere Länder der Welt nicht mitziehen. Daher braucht es ein realitätsbasiertes Koppelungsprinzip. Der CO2-Preis sollte proportional zum Anteil der global bepreisten Emissionen steigen. Wenn etwa 10 Prozent der weltweiten Emissionen bepreist sind, läge der nationale CO2-Preis bei 10 Prozent des globalen Optimums – also rund 6 US-Dollar.
Dieses Koppelungsprinzip verhindert Übersteuerung, erhöht die internationale Anschlussfähigkeit und schafft innenpolitische Legitimität: Wenn andere mehr tun, tun wir mehr. Bleiben andere untätig, bleibt auch die eigene Last sehr begrenzt. Wohlfahrtsschädlich Klimaschutzregulierungen können auch bei einer Bepreisung nach dem Koppelungsprinzip vollständig abgebaut werden. Denn entweder kommt es zu globalem Klimaschutz oder eben nicht. Wenn nicht, wirken weder nationale Klimaschutzregulierungen noch CO2-Bepreisung gegen den Klimawandel; nur ist die Bepreisung wesentlich günstiger als Regulierung.
Blog-Beiträge der Serie „Europäischer Emissionshandel in der Kritik“
Achim Wambach (ZEW, 2025): Weiter freie Zertifikate
Jan Schnellenbach (BTU, 2025): Die Gefahren des Kampfes gegen den Emissionshandel
Podcast zum Thema:
Emissionshandel unter Druck. Steht die (marktwirtschaftliche) Klimapolitik auf der Kippe?
Prof. (em.) Dr. Norbert Berthold (JMU) im Gespräch mit Prof. Achim Wambach, PhD (ZEW)
Blog-Beiträge zum Thema:
Norbert Berthold (JMU, 2025): Klima im Wandel: Wende in der (europäischen) Klimapolitik?
Joachim Weimann (OVGU, 2025): Beim Klima nichts Neues
Reint E. Gropp und Oliver Holtemöller (IWH, 2024): Sechs Punkte für mehr Effizienz
Video zum Thema:
Joachim Weimann (OVGU, 2021): Was ist gute Klimapolitik?