„Das kapitalistische Wirtschaftssystem hat keine Zukunft mehr.“ (Heiner Geißler in einem ZDF-Interview am 19.10.2011)
Das Einprügeln auf die angebliche Gefährdung der Gesellschaft durch den ungezügelten Raubtierkapitalismus – das Kapitalismus-Bashing – gehört in Intellektuellenkreisen wohl inzwischen zum guten Ton. Wirklich bedenklich wird die wenig reflektierte Kapitalismuskritik jedoch erst dadurch, dass sie in den Massenmedien einen immer größeren Raum findet und – langsam aber sicher – die Soziale Marktwirtschaft als Wirtschaftsordnung ihrer gesellschaftlichen Basis beraubt. Wenn der CSU-Vorsitzende Horst Seehofer auf einem Parteitag (8.10.2011) behauptet „Marktwirtschaft pur ist Wirtschaft pervers“, so mag man dies als billigen Populismus abtun oder man mag es auch als Symptom für die reale Gefährdung der Grundlagen des Reichtums unserer Gesellschaft ansehen.
Dass hier tatsächlich ein ernstzunehmendes Problem vorliegt, zeigt auch eine infratest dimap-Umfrage, die im Februar 2012 im ARD-DeutschlandTREND publiziert wurde: 51 Prozent der Befragten sind der Auffassung, die Soziale Marktwirtschaft in Deutschland müsse „grundlegend verändert werden“ und 77 Prozent der Befragten glauben, die Soziale Marktwirtschaft mache die Armen ärmer.
Solch grobe und weit verbreitete Fehleinschätzungen bedürfen dringend einer Korrektur – vor allem außerhalb der Fachzeitschriften. Im November 2012 hat Thomas Apolte in einem lesenswerten Aufsatz in diesem Blog hierzu einen Beitrag geliefert. Seine allgemein gehaltene Argumentation betont zwei Aspekte: Zum einen sind bei den großen Themen Entwicklung, Ungleichheit, Umweltbelastung und Gefährdung der Demokratie keineswegs Marktprozesse als Ursache anzusehen. Zum anderen fehlt den Kritikern jegliches Konzept einer besser funktionierenden Alternative. Dem soll hier uneingeschränkt zugestimmt werden.
Abweichend von Apolte sollen im Folgenden jedoch einige konkretere Aspekte der Kapitalismuskritik angesprochen werden. Die erste Frage hierzu lautet: Sind die gegenwärtigen Finanzmarkt-, Staatshaushalts- und Beschäftigungskrisen die Folge eines umfassenden Marktversagens? Die zweite Frage lautet: Was sagen denn eigentlich die Daten zur Behauptung, der Kapitalismus mache die Armen ärmer?
1. Marktsystem als Sündenbock
Beginnen wir mit einer ersten Richtigstellung: In den Medien wird gern argumentiert, Marktwirtschaft pur (siehe Seehofer) oder der Raubtierkapitalismus in seiner vorliegenden Form habe die aktuellen gesellschaftlichen Probleme erzeugt. Damit dieser Art des Kapitalismus die Schuld überhaupt erst zugeschoben werden kann, muss es diesen zumindest geben. Es fragt sich nur: Wo?? Die Bundesrepublik Deutschland kann unmöglich gemeint sein. Bei uns gibt es gewisse Bereiche, die die Politik den Bürgern überlässt, um private Geschäfte abzuschließen. Von einer Marktwirtschaft pur sind wir jedoch meilenweit entfernt. Ist der Raubtierkapitalismus vielleicht ausgeprägter in jenen Ländern, in denen die Krise besonders ausgeprägt ist? Auch dies muss wohl verneint werden. Griechenland, Spanien, Portugal, Italien und (demnächst) Frankreich haben mit Sicherheit keine Wirtschaftsordnungen, die dem freien Kapitalismus größere Spielräume ließen als dies in Deutschland oder den USA der Fall ist. Wenn es die reine Marktwirtschaft in all den Problemländern gar nicht gibt, wie kann sie dann Schuld daran sein, dass die aktuellen Probleme entstanden sind?
Man kann die Kritik jedoch auch sachlicher formulieren: Sind die Krisen vielleicht das Ergebnis eines Marktversagens? In gewisser Weise schon. Man kann durchaus die Position vertreten, die Deregulierung des Finanzmarktsektors sei über das Ziel hinausgeschossen und eine wichtige Krisenursache. Dabei sollte man allerdings nicht vergessen, dass das übermäßige Eingehen von Risiken nicht zuletzt eine Folge der (im Nachhinein bestätigten) Erwartung ist, der Staat werde die Finanzinstitute im Krisenfall schon retten. Unter solchen Bedingungen herrschen Idealvoraussetzungen dafür, mit anderer Leute Geld Roulette zu spielen. Der Staat hat somit offenkundig einen Teil der Schuld zu tragen!
Der Beitrag der Staaten an der Krisenentstehung ist jedoch noch weit größer. Ein zentraler Punkt ist, dass die Geldpolitik seit Ende der 80er Jahre immer expansiver geworden ist. Unter dem Stichwort „Great Moderation“ glaubte man jegliche Finanz- oder Wirtschaftskrise durch eine entsprechend expansive Politik im Keim ersticken zu können. Der Wirtschafts-Nobelpreisträger Robert Lucas hat sich dazu wie folgt geäußert: „[…] that macroeconomics in this original sense has succeeded: Its central problem of depression prevention has been solved, for all practical purposes, and has in fact been solved for many decades.“ (Lucas, 2003, S.1) Von Krise zu Krise hat man die Zinsen weiter gesenkt und damit die eigentlichen Problemursachen verdeckt und verstärkt. Gleichzeitig hat man eine Blase an den Vermögensmärkten erzeugt, deren Platzen in den Jahren 2007 bis 2009 deutlich sichtbar war. Die Politik der „Great Moderation“ wurde jedoch durch die Staaten vorgenommen, sie ist kein Produkt der Marktprozesse.
Auch die Staatsschuldenkrise ist nicht primär durch Marktprozesse hervorgerufen worden. Regierungen neigen dazu, sich ihr eigenes Handeln dadurch zu erleichtern, dass man die mit dem Verteilen von Wohltaten verbundenen Lasten auf folgende Politikergenerationen verlagert. Haushaltsdefizite sind keine Erfahrung der letzten fünf Jahre, sondern eher eine der letzten 500 Jahre. Um sich dies zu erleichtern, hat sich die Politik selbst einige Privilegien eingeräumt. Ein Beispiel hierfür ist, dass Geschäftsbanken für Kredite an den Staat – im Gegensatz zu Krediten an private Personen oder Organisationen – kein Eigenkapital halten müssen. Die Banken werden also gezielt dazu geleitet, Kredite vorrangig an die Träger öffentlicher Haushalte zu vergeben.
Schließlich wird gern argumentiert, Haushaltsdefizite seien als konjunkturpolitisches Instrument zur Vermeidung kurzfristiger Abschwünge unverzichtbar. Dieses Argument findet inzwischen seit mehr als vier Jahren Verwendung, ohne dass die Konjunkturprobleme vergehen. Die keynesianische Konjunkturtheorie ist jedoch explizit als Instrument zur Analyse kurzfristiger Schwankungen ausgestaltet. Doch wie lang ist diese kurze Frist eigentlich? „Langfristig sind wir alle tot“, so kokettierte Keynes mit dem Vertrauen auf langfristige Marktprozesse, die Wirtschaftskrisen lösen sollen. Heute könnte man zurückfragen: „Könnte es vielleicht sein, dass sich die kurze Frist und die lange Frist, in der wir alle tot sind, einander erschreckend annähern?“
Wenn man, wie der Verfasser dieser Zeilen, davon ausgeht, dass die aktuellen Krisen im Wesentlichen die Folge von Strukturverzerrungen sind, dann führt die expansive Geld- und Fiskalpolitik primär dazu, dass unwirtschaftliche Strukturen aufrecht erhalten und verfestigt werden. Damit wird nicht das eigentliche Problem gelöst, es werden nur Symptome kuriert. Eine Restrukturierung bedingt jedoch, dass Ressourcen von einem Bereich in andere Sektoren der Wirtschaft verlagert werden. Dazu müssen Arbeitsplätze in einigen Sektoren abgebaut werden. Bevor jedoch die neuen Kapazitäten verfügbar sein werden, können die freigesetzten Arbeitnehmer nur schwer zu alten Konditionen beschäftigt werden. Damit wäre ein höheres Maß an Lohnflexibilität hilfreich, Beschäftigungsprobleme in Grenzen zu halten. Doch es liegt nicht an den Märkten, dass diese Flexibilität fehlt.
Eine Marktwirtschaft ist kein nach-paradiesischer Zustand mit permanenter Effizienz. Der Marktprozess ist stattdessen ein flexibler Versuch-und-Irrtums-Prozess, der zu einem unerreicht hohen Maß an Koordination der einzelwirtschaftlichen Entscheidungen und zu historisch einmaligem Produkt- und Verfahrensfortschritt führt. Dabei ist es jedoch von grundlegender Bedeutung, dass die unvermeidlichen Irrtümer in diesem Suchprozess korrigiert werden. Hindert man den Marktprozess daran, diese Korrekturen vorzunehmen, indem man die alten Strukturen zu erhalten sucht, so nimmt man dem Marktprozess die Grundvoraussetzung für seine Wirksamkeit.
Dass der Marktprozess in der Tat wirksam und nach gegenwärtigem Stand des Wissens unverzichtbar ist, soll in den folgenden Abschnitten skizziert werden.
2. Marktprozesse im historischen Kontext
Die Konzentration auf hier und jetzt zu lösende Probleme führt nicht selten dazu, dass die Menschen den Blick für das Große und Ganze verlieren. Stellt man den Marktprozess in Frage, dann gefährdet man die zukünftige Ernte des durch ihn ausgelösten Fortschritts. Dass die zu erwartenden Früchte des über den Markt zu realisierenden Fortschritts groß sein können, zeigt der Blick in die Vergangenheit. Es ist kein Zufall, dass medizinischer, ökonomischer und sozialer Fortschritt immer zuerst in Nationen auftreten, die den Markt intensiver nutzen als andere. Hans Roslings unterhaltsames Video visualisiert dies sehr deutlich.
Hier soll jedoch ein anderer Weg eingeschlagen werden, um die enorme Kraft marktwirtschaftlicher Prozesse zu verdeutlichen. Dazu betrachten wir im Folgenden die Minuten Arbeitszeit, die ein Arbeitnehmer benötigt, um sich gewisse Konsumgüter zu kaufen. Als Konsumgüter habe ich Butter, Käse, Schweinefleisch und Bier ausgewählt. Zum Vergleich des Wohlstands wurden die Jahre 1600, 1800 und 1960 gewählt. Für 1960 gibt es eine Statistik des Instituts der deutschen Wirtschaft (IDW) zur Kaufkraft der Lohnminute, die ich im Folgenden verwende (Institut der deutschen Wirtschaft, 2011, S.57). Für 1600 und 1800 ist die Ermittlung der erforderlichen Daten natürlich schwieriger. Gerhard und Engel (2006) liefern hierzu einige Anhaltspunkte. Für die folgende Tabelle werden die von diesen Autoren gefundenen Zahlen des Hospitals St. Hiob (im Raum Hamburg) für den durchschnittlichen Tageslohn eines ungelernten Arbeiters sowie die Preise für Butter, Käse, Schweinefleisch und Bier genutzt.
Der Lohn für den ungelernten Arbeiter ist dabei keineswegs als gering einzustufen. Im Vergleich verdienen Knechte, Krankenmägde, Küchenwirte oder weibliche ungelernte Arbeitskräfte deutlich weniger. Nur die Schiffsbauer verdienen in der entsprechenden Statistik einen höheren Tageslohn. Um auf den Stundenlohn zu kommen, muss eine Annahme über die tägliche Arbeitszeit getroffen werden. Allgemein geht man von einem Arbeitstag zwischen Sonnenauf- und –untergang unter Berücksichtigung der fälligen Pausen aus. Im Durchschnitt beträgt die Tageszeit etwa 12 Stunden. Zieht man hiervon vier Stunden für Pausen ab, dann dürfte die resultierende Schätzung klar eine untere Grenze für die tatsächliche Arbeitszeit darstellen und damit den Stundenlohn signifikant überschätzen. Unter dieser Annahme ergibt sich ein (optimistischer) Stundenlohn von 9,125 Denaren (Pfennigen) in 1603 bzw. 18 Denaren in 1798.
Im Jahr 1603 kostete eine Tonne Bier 984 Denare (bzw. 5 lübische Mark und 2 lübische Schillinge). Eine Tonne entspricht 48 Stübgen und ein Stübgen beinhaltet 3,62 Liter. Folglich enthält eine Tonne Bier 48 mal 3,62 Liter, also 173,76 Liter. Ein halber Liter Bier kostet demnach 984/(2â‹…173,76) = 2,83 Denare. Teilt man diesen Preis durch den Stundenlohn, so ergibt sich eine Arbeitszeit von 0,31 Stunden (also 18,61 Minuten) für den Kauf eines halben Liters Bier. In analoger Weise wurden auch die restlichen Daten aus Tabelle 1, die den Arbeitszeitaufwand pro Konsumgütereinheit erfasst, berechnet.
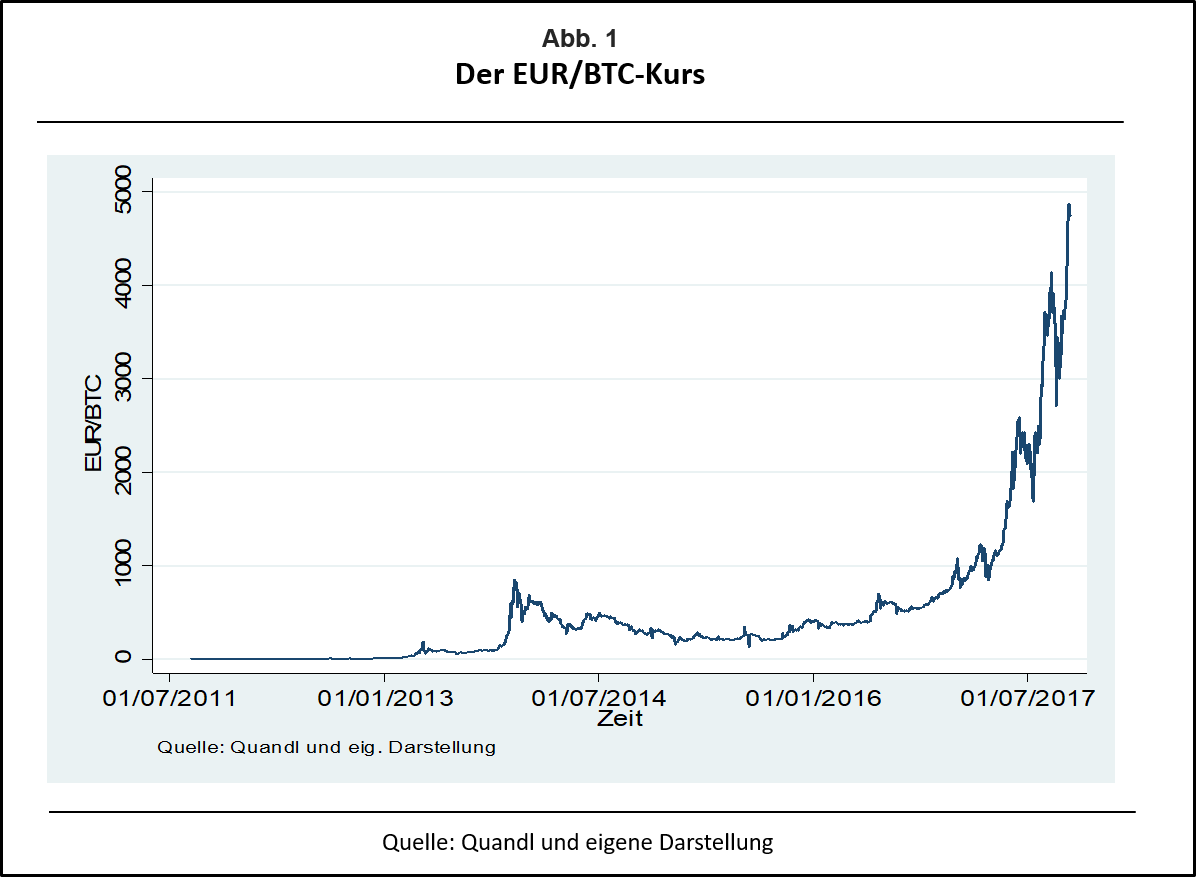
– zum Vergrößern bitte auf die Grafik klicken –
Tabelle 1 zeigt, dass die Arbeitszeit, die ein Arbeitnehmer für die jeweiligen Konsumgüter opfern musste von 1600 nach 1800 angestiegen ist. Danach hat der Prozess der Industrialisierung zu einer deutlichen Verringerung der erforderlichen Arbeitszeit geführt. Die Steigerung der Kaufkraft einer Arbeitsminute ist demzufolge um 390 Prozent (Butter), 136 Prozent (Käse), 244 Prozent (Schweinefleisch) bzw. 27 Prozent (Bier) gestiegen. Man beachte, dass die hier angeführte Rechnung den Stundenlohn der Arbeitnehmer von 1600 und 1800 vermutlich deutlich überschätzt.
Der Marktprozess hat somit bewirkt, was im folgenden, vermutlich von Friedrich dem Großen stammenden Spruch zum Ausdruck kommt: „Wer bewirkt, dass dort, wo bisher ein Halm wuchs, nunmehr zwei Halme wachsen, der hat mehr für sein Volk getan als ein Feldherr, der eine Schlacht gewann.“
Doch natürlich liefert ein Marktsystem nicht nur mehr vom Gleichen, sondern vor allem auch viel Neues. Dies beginnt bei der besseren medizinischen Versorgung, geht über die neuen Mittel des Güter- und Personentransports bis hin zu neuen Kommunikationstechnologien. All dies wurde hier – wegen der Nichtvergleichbarkeit – ausgeblendet.
3. Hat der Markt seine Aufgabe bereits erledigt?
Doch – so mag man vielleicht in Anlehnung an Marx oder Schumpeter glauben – vielleicht hat der Kapitalismus seine Funktion ja inzwischen ausgeübt und ist nunmehr überflüssig und reif für eine Ablösung? Diese Frage zu beantworten ist schwierig, schließlich kennt niemand die Zukunft. Sollte jedoch in den vergangenen 50 Jahren noch immer ein vergleichbarer Fortschritt vorgeherrscht haben, wie in den vergangenen 200 Jahren, spricht zunächst einmal nichts gegen die wohlstandsgenerierende Dynamik der Marktprozesse. Die Beweislast, dass jetzt plötzlich alles anders sei, liegt folglich bei denjenigen, die glauben auf den Kapitalismus verzichten zu können. Tabelle 2 liefert einen Überblick über ausgewählte Konsumgüterpreise (in Arbeitsminuten) zwischen 1960 und 2010.

– zum Vergrößern bitte auf die Grafik klicken –
Es wird deutlich, dass der Markt auch heute seine Bedeutung als Mittel zur Wohlstandsmehrung nicht verloren hat und die Dynamik ungebrochen ist. Wer könnte bestreiten, dass die in Tabelle 2 angeführten Produkte die Lebensqualität der Konsumenten deutlich erhöht haben und dies für ein immer kleiner werdendes Opfer in Form von Arbeitszeit. Die Kaufkraft der Lohnminute (gerechnet in Fernsehern) hat sich seit 1960 mehr als verdreißigfacht! Doch selbst diese Relation unterschätzt die Wohlstandswirkung, da sich die Qualität der Fernsehgeräte seit 1960 erheblich verbessert hat. Andere Produkte, wie Mobiltelefone, DVD-Player, Notebooks oder Tablet-Computer, die unser Leben heute maßgeblich bereichern, können hier nicht aufgelistet werden, da es sie 1960 noch gar nicht gab. Vermutlich hat man 1960 noch nicht einmal daran gedacht, dass es sie geben könnte.
4. Der Blick nach vorne
Es ist nicht das Ziel dieses Beitrags, das Ausmaß der Krise oder die persönlichen Folgen für viele der Betroffenen herunterzuspielen. Doch wenn die gegenwärtigen Probleme dazu führen, dass weite Teile der Bevölkerung vermuten, das Marktsystem mache arme Menschen noch ärmer, dann muss solchen Einschätzungen energisch entgegengetreten werden.
Wir haben uns inzwischen daran gewöhnt, die Armutsgrenze auf 60 Prozent des Medianeinkommens zu legen. Betrachtet man jedoch einen demnach Armen des Jahres 2010, der nur 40 Prozent des Durchschnittslohnes erhält, so muss auch dieser sehr arme Bürger für einen Kühlschrank 3510 Minuten arbeiten, also 5814 Minuten (ca. 100 Stunden) weniger als der durchschnittliche Lohnempfänger im Jahr 1960. In Tabelle 2 wären nur der Kinobesuch und das Benzin teurer, für alle anderen Produkte muss der Geringverdiener im Jahr 2010 (zumeist deutlich) weniger lange arbeiten als ein Durchschnittsverdiener des Jahres 1960.
Die Soziale Marktwirtschaft macht somit die meisten Menschen reicher, auch die meisten Armen. Doch wenn wir auch zukünftig ihre Früchte genießen wollen, dann ist es dringend geboten, so viele Menschen wie möglich darauf hinzuweisen und der zunehmend marktfeindlichen Stimmung in Medien und Politik entgegenzuwirken.
Literatur
- GERHARD, HANS-JÜRGEN / ENGEL, ALEXANDER (2006), Preisgeschichte der vorindustriellen Zeit, Stuttgart.
- INSTITUT DER DEUTSCHEN WIRTSCHAFT (2011), Deutschland in Zahlen, Köln.
- LUCAS, ROBERT E. (2003), Macroeconomic Priorities, American Economic Review, Bd. 93, Heft 1, S. 1-14.
- Wie hart soll die EU bei Neuverhandlungen des Brexits verhandeln? - 18. Februar 2019
- Reden ist Silber, Schweigen ist Gold?
Wie sollen sich Wirtschaftswissenschaftler in der wirtschaftspolitischen Diskussion verhalten? - 23. September 2018 - Vertrauen
Unverzichtbare, aber zerbrechliche Grundlage des sozialen Konsenses - 14. März 2018

Die Marktwirtschaft selbst ist doch gar nicht das Problem.
Im Gegenteil, Marktwirtschaft, Handel und das Prinzip von Angebot und Nachfrage sind essentiell wichtig für eine menschliche Gesellschaft.
Das Problem ist die extreme Kapital-, Macht- und Wissenskonzentration in den Händen von wenigen.
Beispiel: Aktienhandel – ein Kleinanleger hat doch überhaupt keine Chance gegen die Grosshändler von Goldmann Sachs, JP Morgan, usw.
Diese Großbanken beherrschen den Markt, steuern die Kurse und rasieren (scalping) die kleinen Aktionäre.
Es gibt keine Chancengleichheit.
Oder nehmen wir die großen, global agierenden Nahrungsmittelkonzerne.
Als Verbraucher wird man getäuscht und abkassiert.
Nicht die Marktwirtschaft hat versagt sondern Kartellbehörden und Steuergesetzgebung.
Banken hätten niemals eine globale Marktmacht erhalten dürfen.
Angenommen es würde nur Sparkassen, Volks- und Raiffeisenbanken geben, das wäre völlig ausreichend um die Marktwirtschaft mit Geld zu versorgen.
„Beispiel: Aktienhandel – ein Kleinanleger hat doch überhaupt keine Chance gegen die Grosshändler von Goldmann Sachs, JP Morgan, usw.“
Es ist genau anders herum, die Großanleger haben keine Chancen gegen die Kleinanleger. Während die Großanleger oft politische Gründe in ihre Anlageentscheidungen einfließen lassen, kann der Kleinanleger in Ruhe seine Strategie durchziehen. Wenn ich eine Aktie 3 bis 5 Jahre lang liegen lasse interessiert mich Scalping recht wenig.
Haha, Heiner Geißler, der Meister Yoda der deutschen Politik. Ich lach mich kaputt. Wer hört ihm eigentlich noch zu ?