Griechenland stieg 2007 mit einer Verschuldungsquote von gut 107 Prozent in die Finanzmarktkrise ein, Italien mit über 103 Prozent. Portugal lag bei etwas mehr als 68 und Zypern bei knapp 59. Dagegen wies Spanien nur einen Schuldenstand von 36 Prozent auf und Irland kam gerade einmal auf 25 Prozent. Gleichwohl ist allen diesen Ländern gemein, dass sie wenig später zu den so genannten Problemländern der Eurozone gehörten, die entweder unter die Rettungsschirme von EFSF oder ESM schlüpften oder doch durch Wertpapierkäufe der EZB einstweilen vor den Folgen krisenhafter Wertpapierkursverluste bewahrt wurden – und das bei Schuldenständen von zwischen 25 und 107 Prozent! In der Tat ist der Verweis auf eine intrinsische Schuldenneigung der zuständigen Finanzminister vor der Krise bei weitem nicht ausreichend, um die Ursachen der Eurokrise zu ergründen. So ist es denn auch nicht verwunderlich, dass sich – wenn man so will – auf einer mittleren Ebene der Ergründung jeder seine Lieblingshypothese darüber heraussucht, was die wirklichen Hintergründe der Krise seien. Da finden die einen die Finanzmärkte und überhaupt das Versagen der Märkte mitsamt ihren bisweilen zügellosen Akteuren, während andere den öffentlichen Sektor und seine Unfähigkeit zu nachhaltigem Finanzgebaren anprangern, und jeder mag am Ende in der einen oder anderen Hinsicht Recht haben.
Tatsächlich finden sich alle diese Erklärungsmuster aber bestenfalls auf einer mittleren Ebene der Erklärung, denn alle dort identifizierten Erscheinungen dürften ihrerseits Symptom einer noch tieferen Ursache sein. Und wenn das zutrifft, dann sind die Auseinandersetzungen über die Frage, ob Staats- oder Marktversagen ursächlich ist oder ob wir es mit Systemproblemen oder der ausufernden Gier in einer zunehmend hedonistischen Welt zu tun haben, alle reichlich fruchtlos. Nehmen wir stattdessen einmal an, dass wir Menschen immer und zu allen Zeiten eine Neigung dazu hatten, über unsere Verhältnisse zu leben oder – wie Eugen von Böhm-Bawerk es seinerzeit ausgedrückt hat – den Gegenwartskonsum dem Zukunftskonsum vorzuziehen. Dann bedarf es bestimmter Mechanismen oder Regeln, um uns vor unliebsamen Spätfolgen dieser Neigung zu bewahren. So stehen private Haushalte ebenso wie hinreichend unbedeutende Unternehmen stets der Insolvenzdrohung gegenüber, die zwar nicht alle, aber doch die meisten von ihnen davor bewahrt, Schuldnerpositionen aufzubauen, die sie später nicht mehr bewältigen können. Hierzu ist es allerdings nötig, dass erstens die Folgen heutigen Handelns für die Zukunft hinreichend transparent sind und dass es zweitens keine Möglichkeiten gibt, diese Folgen auf andere abzuwälzen. An beidem hat es wiederum überall und zu allen Zeiten gemangelt, wenn auch in unterschiedlichem Maße.
So haben öffentliche Haushalte im Prinzip immer und überall die Eigenschaft, die zweite Bedingung sehr unzureichend zu erfüllen und damit Schuldenpositionen aufzubauen, deren Folgen andere dann irgendwann einmal ausbaden müssen. Auf diese Weise bricht sich im Rahmen großer Kollektive und Staaten die Neigung der Menschen Bahn, über ihre Verhältnisse zu leben. Konsequenterweise ist die Geschichte der Staatsverschuldung und der Staatspleiten lang und illustrativ. Finanzmärkte haben dagegen eine ganz andere Eigenschaft, die den Menschen aber ebenfalls Raum dafür geben kann, über ihre Verhältnisse zu leben, wenn die Regeln der Finanzmärkte unglücklich gesetzt sind. Das liegt daran, dass die Entscheidungen auf diesen Märkten auf Informationen beruhen, über die man erst in einer mehr oder weniger fernen Zukunft verfügen wird. Oft ist nicht einmal die Wahrscheinlichkeitsverteilung dessen bekannt, was auf Finanzmärkten einzuschätzen ist, so dass ein vernunftgeleiteter Umgang mit der Unsicherheit und Unwissenheit erschwert ist.
Wenn nun die Regelwerke der Finanzmärkte Raum für Illusionen über die Zukunft geben und vielleicht zusätzlich noch die Erwartung genährt wird, dass die Folgen von Fehlentscheidungen von der Gemeinschaft übernommen werden, dann haben wir die besten Voraussetzungen dafür vorliegen, dass Finanzmärkte Blasen bilden. Solche Blasen beruhen im Grunde immer wieder darauf, dass an bestimmten Stellen – meist unbemerkt und nicht selten von niemandem gewollt – Kettenbriefsysteme gestartet werden, innerhalb derer neue Vermögenspositionen entstehen, ohne dass dies mit Wertschöpfung verbunden ist, merkwürdigerweise aber auch ohne dass jemand unmittelbare Vermögensverluste realisieren muss. Alle Beteiligten an einer Folge von Markttransaktionen halten dann ihr persönliches Vermögen für vergrößert; aber mindestens einer der Beteiligten erwartet künftige Zahlungseingänge, die es objektiv gesehen nie geben wird. Ob eine Folge von Finanzmarkttransaktionen einen solchen Kettenbriefcharakter oder aber einen auf Wertschöpfung beruhenden Nachhaltigkeitscharakter hat, das weiß man nie mit Gewissheit. Hätten wir nämlich Gewissheit, dann würden Kettenbriefe gleich vor der ersten Zahlung abgebrochen, es sei denn, der letzte in der Kette hätte die begründete Aussicht, seine Verluste wiederum auf andere abwälzen zu können. Da wir aber keine Gewissheit haben, sind wir auch nie ganz vor Kettenbriefeffekten geschützt, seien sie nun gewollt oder ungewollt in Gang gesetzt worden.
So können wir festhalten, dass Unsicherheit in Verbindung mit Anreizen zu unvorsichtigen Entscheidungen die Zutaten sind, die der Neigung von uns Menschen zum Leben über unsere Verhältnisse den Raum gibt, den sie braucht, um Krisen zu erzeugen. Und die Anreize zu unvorsichtigem Verhalten erzeugt man durch implizite oder explizite Versprechen zur Übernahme von Verlusten, aber auch durch geldpolitische Strategien, welche durch niedrige Zinsen die Illusion fehlender Kapitalknappheit nährt. Und stellt sich dann irgendwann heraus, dass Kettenbriefeffekte ausgelöst wurden, dann werden die Vermögensverluste der Kette sofort offenbar, und es muss ein Weg gefunden werde, diese zu verteilen. Daran geht schon rein sachlich kein Weg vorbei, auch wenn die Realität durch abermalige Verschuldung oder durch Geldschöpfung verkleistert werden mag. Dass letzteres die Anpassungsleiden vermindert, ist eine Behauptung, die bis heute einer Begründung harrt, die aber zu Recht gern mit dem Schnaps verglichen wird, dem man einem Alkoholiker zur Linderung seiner Entzugsleiden verabreicht. Und wie beim Alkoholiker ist es immer mit Nebenwirkungen verbunden, wenn man die Anpassungsleiden einer Volkswirtschaft mit (abermaliger) Staatsverschuldung, Verlustübernahmen oder mit der Gelddruckmaschine überdeckt: Denn wie beim Alkoholiker untergräbt es die Entstehung von Regeln, die man braucht, um sich nicht nur kurzfristig besser zu fühlen, sondern um Dauerhaft krisenfest zu werden, und das sind Regeln, welche die Neigung von uns Menschen im Zaum zu halten imstande sind, über unsere Verhältnisse zu leben – so wie ein Suchtkranker ja im Prinzip auch neue Regeln braucht, um sich selbst daran zu hindern, mit Hilfe des Suchtstoffs über seine mentalen Verhältnisse zu leben.
Als 1992 der Maastrichter Vertrag geschlossen wurde, da war klar, dass die darin enthaltene Verpflichtung zur Einführung einer Europäischen Währungsunion nur unter der Bedingung erfolgen kann, dass alle Mitgliedstaaten die gleichen – oder doch zumindest sehr ähnliche – Regeln für den Umgang mit der Neigung von uns Menschen einhalten, über unsere Verhältnisse zu leben. Das konnte bedeuten, dass alle Staaten einen gleichermaßen laxen oder dass alle einen gleichermaßen strikten Umgang damit pflegen würden. Die Deutschen, die Niederländer und einige andere wurden mit dem Versprechen für den Euro gewonnen, dass letzteres die Leitlinie sein sollte, und so kommt dies in der No-bail-out-Klausel, den Fiskalregeln von Maastricht, dem Statut der EZB und einigen anderen Regelungen in der Tat auch zum Ausdruck. Gleichwohl sind gerade die Deutschen gleich zu Anfang arg lax mit diesen Regeln umgegangen. Dann aber, als die Arbeitslosigkeit und die Sozialsysteme in Deutschland aus den Fugen zu geraten drohten, vollzog ausgerechnet Gerhard Schröder mit der Agenda 2010 eine Kehrtwende. Seither laufen die Wirtschaftspolitiken in Europa auseinander, und die Folgen wurden im Nachgang der Subprime-Krise schonungslos offengelegt. Die folgende Abbildung zeigt Quartalsdaten eines Paneldatensatzes der elf ursprünglichen Euro-Länder plus Griechenland von 1999 bis 2012. Auf der horizontalen Achse ist ein Index der Lohnstückkosten (1995=100) und auf der vertikalen Ache der Leistungsbilanzsaldo abgetragen, also im Wesentlichen die Differenz zwischen Exporten und Importen von Gütern und Dienstleistungen.
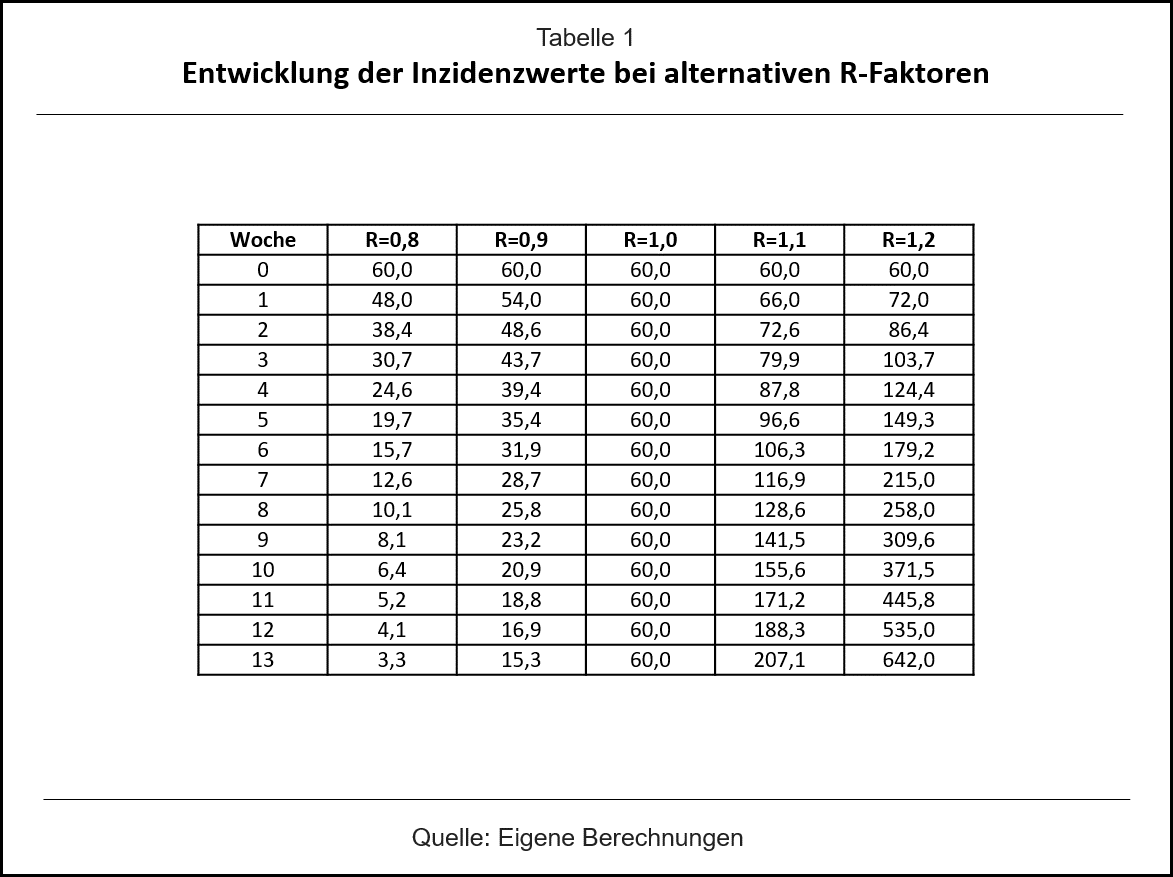
– zum Vergrößern bitte auf die Grafik klicken –
Der Zusammenhang ist überwältigend klar. Je höher die Lohnstückkosten in einem Euroland, desto kleiner ist sein Leistungsbilanzüberschuss (was für rund die Hälfte der Fälle bedeutet, dass das Leistungsbilanzdefizit größer wird). Nimmt man die Daten von Luxemburg als einem Sonderfall mit Blick auf die Leistungsbilanz einmal heraus, so verschwindet der größte Teil der grau hinterlegten Punktewolke rechts oberhalb der 100-Punkte-Marke der Lohnstückkosten, so dass der Zusammenhang noch einmal deutlicher wird. Aber auch unter Einbezug den Daten Luxemburgs bleibt der Zusammenhang hochsignifikant. Selbst wenn man in einer Regression unbeobachtete Länderspezifika (durch fixe Ländereffekte) berücksichtigt, dann sinkt der Leistungsbilanzüberschuss mit jedem Punkt Zunahme auf der Lohnstückkostenskala um 0,53 Prozentpunkte. Das bedeutet, dass eine Zunahme der Lohnstückkosten um zehn Indexpunkte den Leistungsbilanzüberschuss um 5,3 Prozentpunkte verringert. Der Zusammenhang ist hochsignifikant auf dem 1-Prozentniveau (t=-20.46 bei White-Standardfehlern) und erklärt 41 Prozent der gesamten Varianz in den Leistungsbilanzsalden (und immer noch 40 Prozent ohne Berücksichtigung fixer Ländereffekte).
Nun streiten sich die Experten über die Frage, inwieweit Lohnstückkosten der zutreffende Indikator sind, weil letztere in Krisenzeiten durch Entlassungen abwärts getrieben werden, wodurch der Zusammenhang verzerrt wird. Nimmt man daher den Preisindex des Bruttoinlandsprodukts als Maßstab für die Produktionskosten eines Landes, so kommt man praktisch zum selben Ergebnis, wie die folgende Graphik zeigt. Hier sinkt der Leistungsbilanzüberschuss um 0,5 Prozentpunkte, wenn der Preisindex um einen Punkt ansteigt. Das Ganze ist unter Berücksichtigung fixer Ländereffekte ebenfalls auf dem 1-Prozentniveau hochsignifikant (t=-19,33) und erklärt knapp 35 Prozent der Gesamtvarianz.
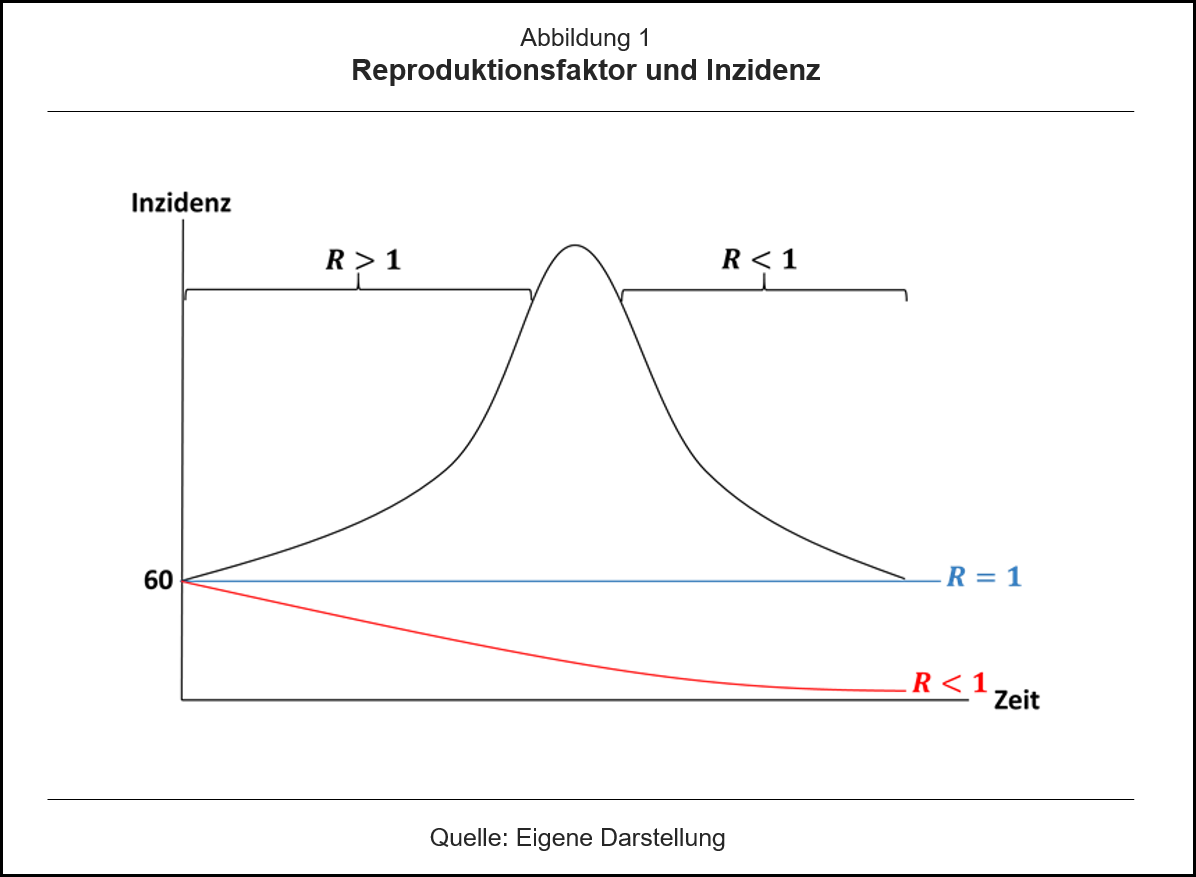
– zum Vergrößern bitte auf die Grafik klicken –
Zum Zeitpunkt des Ausbruchs der Euro-Krise lag Griechenland bei 124 Prozent der Lohnstückkosten Deutschlands, Spanien lag bei 131, Irland bei 122, Portugal bei 117 und Zypern bei 127. Unter solchen Bedingungen in Verbindung mit den gezeigten Effekten von Preis- und Kostensteigerungen auf die Leistungsbilanzsalden kann eine gemeinsame Währung auf Dauer nicht funktionieren, weil die unterschiedlichen Preis- und Kostenentwicklungen nicht mehr im Wege von Auf- und Abwertungen nationaler Währungen ausgeglichen werden können. Vielmehr sind wir zurück in der oben beschriebenen Welt, in der mangelhafte Regelsysteme die Neigung von uns Menschen zum Leben über unsere Verhältnisse den Raum geben, den sie braucht, um handfeste Verschuldungskrisen zu erzeugen – und genau das ist dann ja auch geschehen. Denn das Leben über die Verhältnisse spiegelt sich in den Nettoimporten der südeuropäischen Länder wider, also in deren Leistungsbilanzdefiziten, weil diese maßgeblich von Unterschieden in der Kosten- und Preisentwicklung getrieben werden – wie die Abbildungen zeigen.[1]
Und da spielt es zunächst einmal keine Rolle, ob sich das alles über Staatsverschuldung seinen Weg ebnet oder durch private Verschuldung auf sich aufblähenden Finanz- und Immobilienmärkten. Finanziert werden die Leistungsbilanzdefizite durch Sparer, die auf Konsum verzichten, die stattdessen ihr Geld – direkt oder indirekt über das Finanzsystem – an Konsumenten in anderen Ländern verleihen und die damit schließlich einen spiegelbildlichen Leistungsbilanzüberschuss in ihren Ländern erzeugen – oft genug in der Absicht, damit für ihre Alterseinkommen vorzusorgen und ebenso oft genug, ohne eine Ahnung davon zu haben, dass sie das letzte Glied in einem Kettenbriefsystem sein könnten. Und gerade deshalb bleibt ein solches System genau solange vor dem Kollaps bewahrt, wie die Sparer glauben, dass sie mindestens den Barwert ihres angesparten Geldes zum geplanten Zeitpunkt wieder zurückerhalten. Dabei spielt es wiederum keine Rolle, ob diese Geldgeber ihr Geld an private oder staatliche Stellen verliehen haben. Allein die Erwartung ist maßgebend dafür, welches Vermögen die Menschen auf allen Seiten dieses Spiels zu haben glauben.
In der Folge der Subprime-Krise wurden genau diese Erwartungen enttäuscht und mussten massiv nach unten korrigiert werden, weil überall auf der Welt das Bruttoinlandsprodukt dramatisch fiel und weil damit die Schuldenquoten als Quotient aus Verschuldung und Bruttoinlandsprodukt anstiegen. So war die Subprime-Krise zwar nicht der Verursacher der Eurokrise, wohl aber der Funke, der das europäische Pulverfass entzündete. Griechenland, das seine Schuldenquoten aufgrund des blasenhaften Wachstuns des BIP vor der Krise trotz rasanter Neuverschuldung ein Jahrzehnt lang bei 100 Prozent stabilisieren konnte, flog als erstem der betroffenen Euro-Länder der Schuldenstand um die Ohren. Damit war die Krise offenbar, und die Erwartungen der Geldgeber waren erschüttert; andere Länder folgten und all-überall mussten nun die Verluste aus der Abwertung von Finanzvermögen verteilt werden. Verteilungsfragen sind immer konfliktgeladen, und wenn es um die Verteilung von Verlusten geht, hört meist die Freundschaft auf – so ist es leider folgerichtig, dass man mit einer gemeinsamen Währung bei auseinanderdriftenden Preis- und Kostenentwicklungen zunächst die finanzielle Stabilität und in der Folge der zu verteilenden Verluste auch das friedliche Miteinander aufs Spiel setzt. Eine Währungsunion kann also bestenfalls unter genau spezifizierten Bedingungen zum friedlichen Miteinander beitragen, ansonsten hat sie leider das Potenzial für das ganze Gegenteil – das ist rein sachlich so, und deshalb hilft es wenig, wenn man die beschimpft, die darauf hinweisen.
Werden diese Zusammenhänge in öffentlichen Diskussionen auseinandergelegt, so kann man sich eines bestimmten Einwandes fast schon sicher sein, und der lautet so: Wenn die Divergenz der Preis- und Kostenentwicklung bei Fehlen von Korrekturmöglichkeiten per Abwertung das Herzstück der Probleme darstellt, dann hätte es doch zwei Möglichkeiten gegeben: Entweder passten sich die Länder mit den schneller steigenden Kosten und Preisen den anderen Ländern an oder es passten sich die Länder mit den weniger schnell steigenden Kosten und Preisen den anderen Ländern an. Wäre es demnach nicht besser gewesen, Deutschland hätte sich den anderen Ländern angepasst und seine Löhne und Kosten schneller steigen lassen? Mehr noch: Hat nicht gerade Deutschland mit seinen Arbeitsmarktreformen und seiner Lohnzurückhaltung die divergierende Entwicklung überhaupt erst ausgelöst? Hat Deutschland nicht damit auch interne Armutsprobleme erzeugt, die hier in Deutschland vielleicht gerade noch tragbar waren, in ärmeren Ländern aber unzumutbar, so dass es diesen Ländern unmöglich war, einer solchen Politik zu folgen?
Das Argument hat eine gewisse Logik, denn für die Konvergenz der Preis- und Kostenentwicklung ist es zunächst einmal egal, wer sich wem anpasst. Aber die weiteren Folgerungen aus dem Argument sind allesamt sachlich falsch, und dies erschließt sich bereits durch einfache Anwendung dieser Logik selbst. Der Sinn einer expansiveren Preis- und Kostenentwicklung hätte es sein müssen, die Leistungsbilanzsalden zwischen den Euroländern einzuebnen und damit die gegenseitige Verschuldung von vornherein zu verhindern. Sofern dies durch eine expansivere Lohn- und Kostenentwicklung in Deutschland gelungen wäre, dann hätte dies schon viele Jahre zuvor einen Rückgang des Konsums in Südeuropa erzwungen und damit ebenjene Reallohnsenkung vorweggenommen, die dort heute mangels Wechselkursanpassungen im Wege offener Preis- und Lohnsenkungen unter verständlichem Unmut nachgeholt werden muss. Die Vorstellung, dass die südeuropäischen Beschäftigten bei einer expansiveren Lohnpolitik Deutschlands ein höheres Reallohnniveau hätten halten können und dass ganz nebenbei die deutschen Beschäftigten ebenfalls höhere Reallöhne hätten genießen können, ist also sprichwörtlich zu schön, um wahr zu sein – sie ist Teil einer Geschichte aus dem Schlaraffenland, in dem wir aber bekanntlich nicht leben. Auch in diesem Falle wäre es vielmehr zu einer Korrektur der Tendenz zum Leben über die eigenen Verhältnisse gekommen, nur hätte diese Korrektur gleich zu Beginn eingesetzt.
Aber hätten dann nicht zumindest die deutschen Beschäftigten ein höheres Reallohnniveau genießen können? Wäre es nicht weiterhin so gewesen, dass sich erst gar keine Leistungsbilanzsalden und damit auch keine Verschuldungsprobleme entwickelt hätten, weil die schuldenfinanzierten Güterströme von vornherein nicht nach Südeuropa geflossen wären? Hätten diese Güter dann nicht hier in Deutschland zur Verfügung gestanden und mit ebenjenen höheren Reallöhnen von den deutschen Arbeitnehmern gekauft werden können, welche der expansiveren Lohnpolitik gefolgt wäre? Hätte auf diesem Wege nicht die – so ziemlich genau mit dem Start der Währungsunion 1999 einsetzende – Stagnation des Konsums in Deutschland von Beginn an vermieden werden können? Leider sind auch diese Folgerungen vordergründig so einleuchtend wie sie sich bei näherer Betrachtung als Geschichten aus dem Schlaraffenland entpuppen; denn sie ruhen allesamt auf einem einzigen Trugschluss. Um diesen zu sehen, muss man sich nur noch einmal die Gründe für die Arbeitsmarktreformen der Schröder-Regierung vor Augen führen: Dies war vor allem einmal die hohe Arbeitslosigkeit. Hätte man mit dieser Hypothek eine Politik der Lohnsteigerungen in die Wege geleitet und auf die Arbeitsmarktreformen der Agenda 2010 verzichtet, dann wäre die Arbeitslosigkeit in Deutschland weiter angestiegen und die Produktion wäre gesunken. Dann wären die Güter zwar ebenfalls nicht nach Südeuropa geflossen und deren Finanzierung hätte demnach auch keine Verschuldungskrise auslösen können. Aber hier in Deutschland hätten sie nun ebenfalls nicht mehr zur Verfügung gestanden, und zwar aus einem einfachen Grunde: Sie wären gar nicht entstanden, weil die dazu nötigen Arbeitskräfte keinen Job mehr gehabt hätten, so wie es heute in den Krisenstaaten Südeuropas ebenfalls der Fall ist.
Die nun durch die Krise offengelegten Strukturprobleme in Südeuropa mitsamt der hohen Arbeitslosigkeit und der Perspektivlosigkeit der jungen Menschen hätten wir hingegen in Deutschland und anderen Ländern ebenfalls, und damit wäre schließlich niemandem geholfen. Das ist der Grund, warum es richtig war, die Arbeitsmärkte in Deutschland zu reformieren und eine moderate Lohnpolitik zu betreiben. Es war also nicht egal, welche Ländergruppe sich welcher anderen Ländergruppe anpasst. Allerdings: Die Kombination der Arbeitsmarktreformen der Agenda 2010 mit der laxen Handhabung der Maastrichter Fiskalregeln durch den ehemaligen Bundeskanzler Schröder rächt sich heute bitter, weil die auf diesem Wege sturmreif geschossenen Regeln des Maastrichter Vertrags als Einladung verstanden werden mussten, innerhalb der Währungsunion sehr unterschiedliche Stabilitätspolitiken zu betreiben.
Wollen wir die Währungsunion vor dem Auseinanderfallen bewahren, dann müssen wir zu gemeinsamen Grundregeln über den Umgang mit der Neigung von uns Menschen zum Leben über unsere Verhältnisse finden. Das können wie gesagt gemeinsame laxe oder gemeinsame strikte Regeln sein. Wenn wir aber nicht nur eine Währungsunion, sondern eine prosperierende und finanziell nachhaltige Währungsunion sein wollen, die ihren Kindern eine Zukunft bei niedriger Arbeitslosigkeit in Aussicht stellt, dann brauchen wir gemeinsame strikte Regeln. Freilich ist es das Recht eines jeden Souveräns, hierüber andere Auffassungen zur Geltung zu bringen. Im Rahmen einer Währungsunion ist es aber nicht möglich, hier strikten und dort laxen Regeln zu folgen. Denn dies würde immer neue Krisen erzeugen, und es würde die Bereinigung der Krisen immer wieder massive Konflikte über die Verteilung der Vermögensverluste auslösen, von deren Symptomen die sich derzeit wieder häufenden Bilder deutscher Oberlippenbärtchen nur ein unappetitlicher Vorbote ist. Daher kann man es kaum eindringlich genug formulieren: Wenn wir es nicht schaffen, uns auf verbindliche Regeln über den Umgang mit der Neigung von uns Menschen zum Leben über unsere Verhältnisse zu einigen, dann gibt es fast nichts, was dem europäischen Gedanken so abträglich ist wie eine Währungsunion. Das muss jedem überzeugten Europäer derzeit tiefen Anlass zur Sorge geben.
Fußnoten
- [1]Wenn ein negativer Leistungsbilanzsaldo nicht durch verzerrte Preis- und Kostenentwicklungen, sondern von einem langfristigen Kapitalzufluss angetrieben wird – zum Beispiel durch Direktinvestitionen, mit denen neue Produktionsstätten aufgebaut werden –, dann kann das durchaus ein Symptom einer erfolgreichen Entwicklungsstrategie sein. Aber ein solcher Fall liegt im Euroraum nicht vor.
- Über die Demokratie in Amerika
… und was wir daraus lernen können - 22. Dezember 2025 - Staatsverschuldung und Schuldenbremse
Ein Beitrag zur Erschütterung von Gewissheiten - 14. Juli 2025 - Wie können wir unsere liberalen Demokratien schützen - 30. März 2025

Dies ist für mich eine ehrliche und durchaus relevante analyse!
Danke.