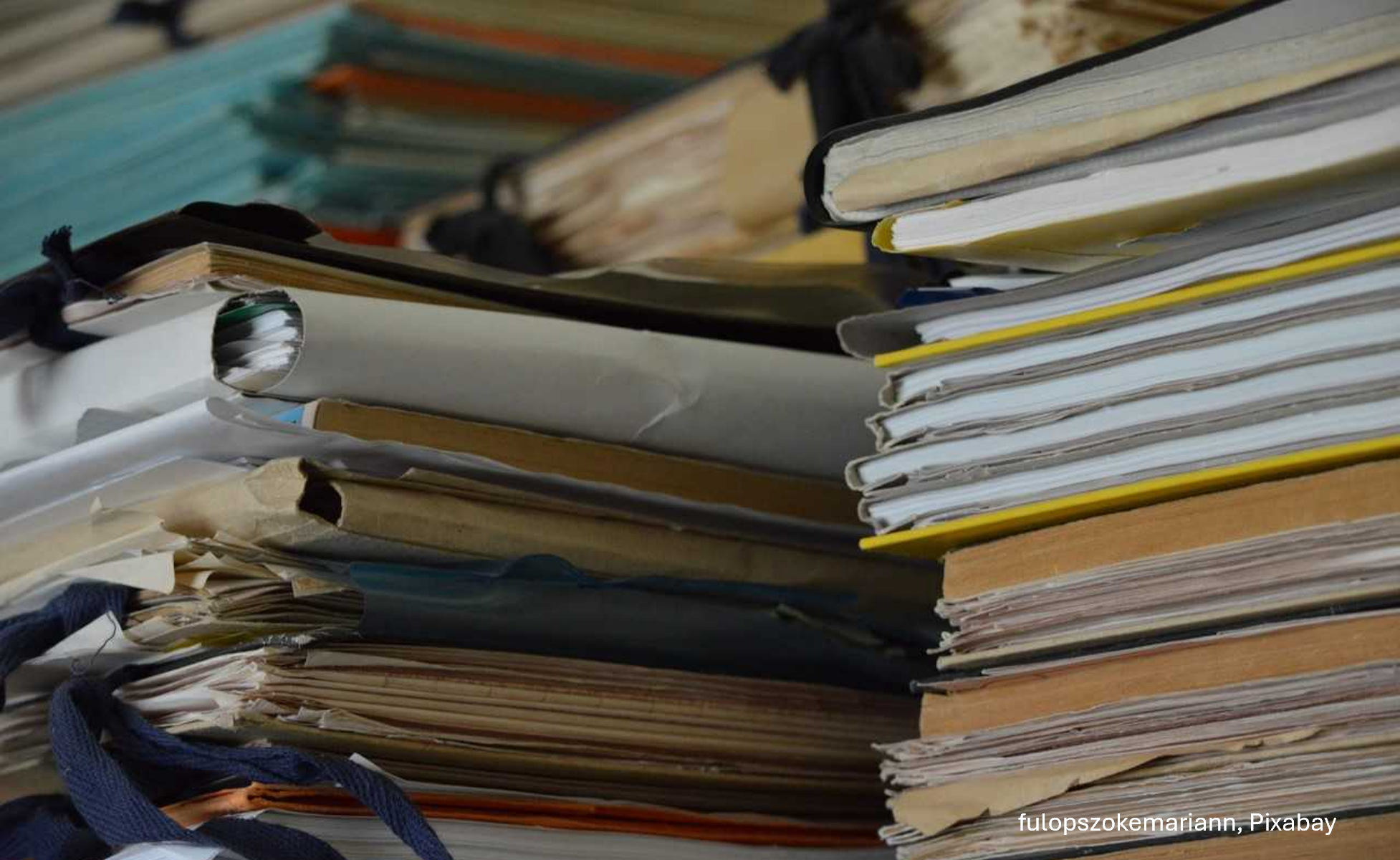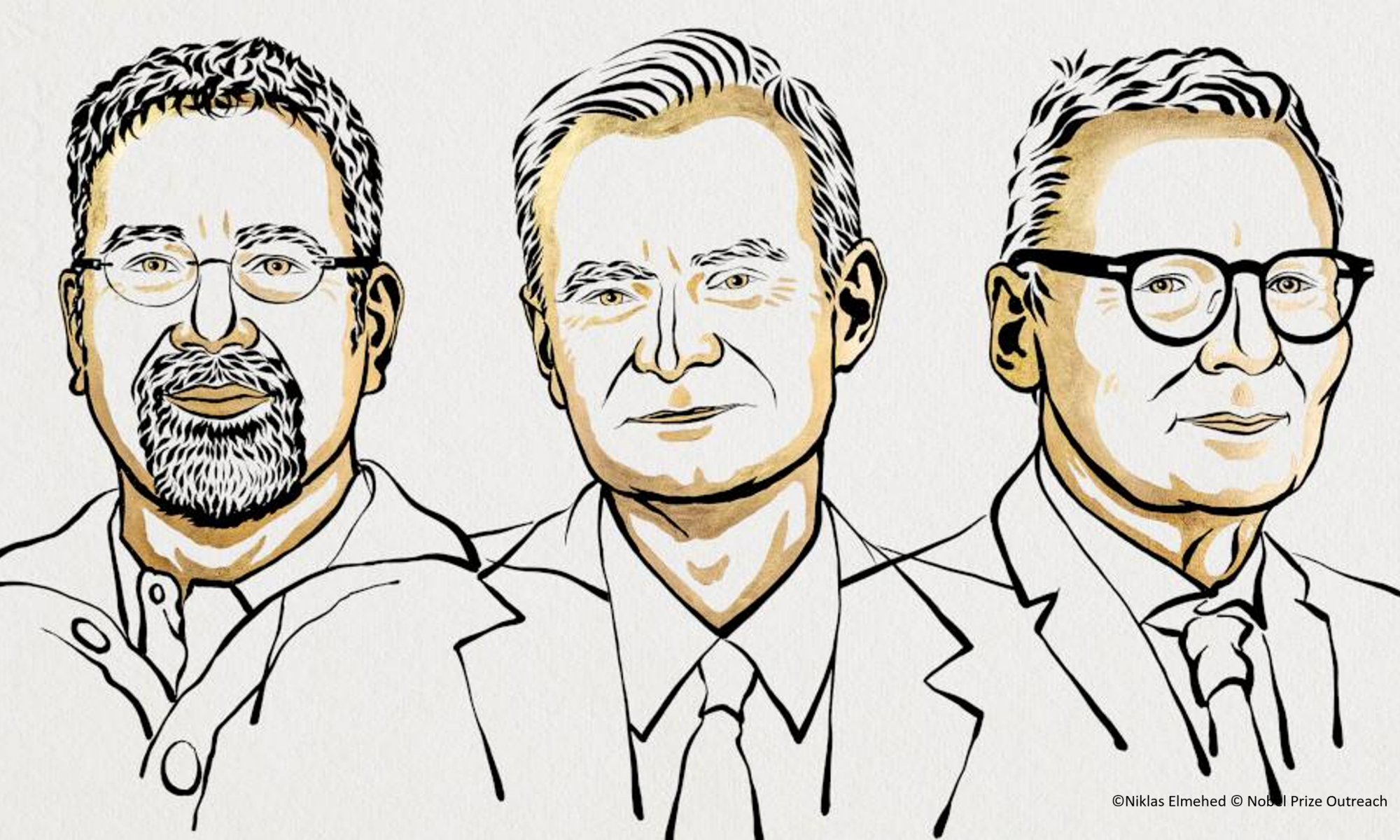Wirtschaftspolitik anders ausrichten (14)
Wirtschaftlicher Stillstand und Reformblockaden
Wie eine neue Institution den Wandel vorantreiben könnte
Deutschland steckt in einer wirtschaftlichen Krise, und dringend benötigte Reformen drohen an politischen Anreizstrukturen zu scheitern. Eine unabhängige Kritikkommission in Form eines „Advocatus Diaboli“ könnte Reformblockaden aufbrechen, indem sie die Regierungspolitik kritisch hinterfragt und konstruktive Gegenvorschläge erarbeitet.