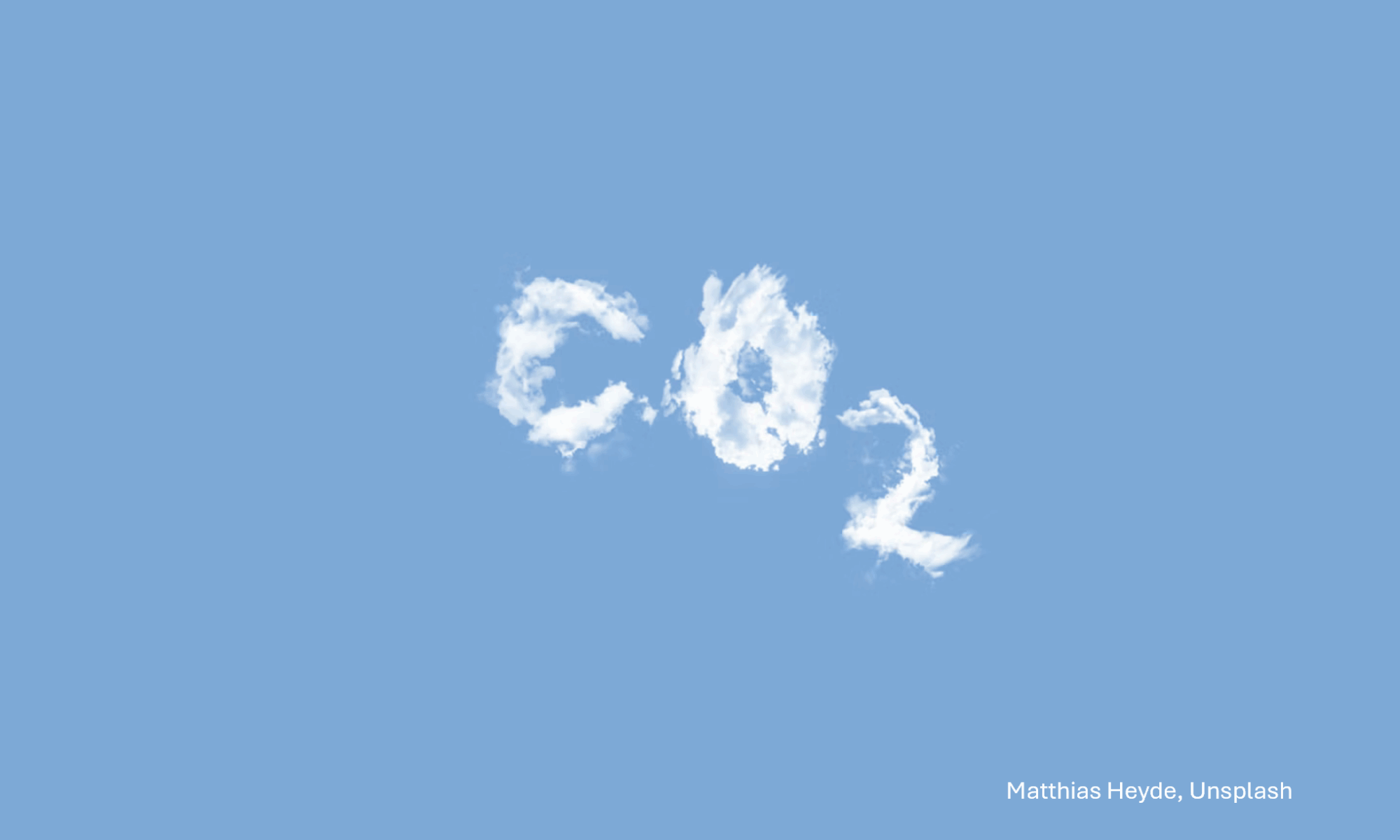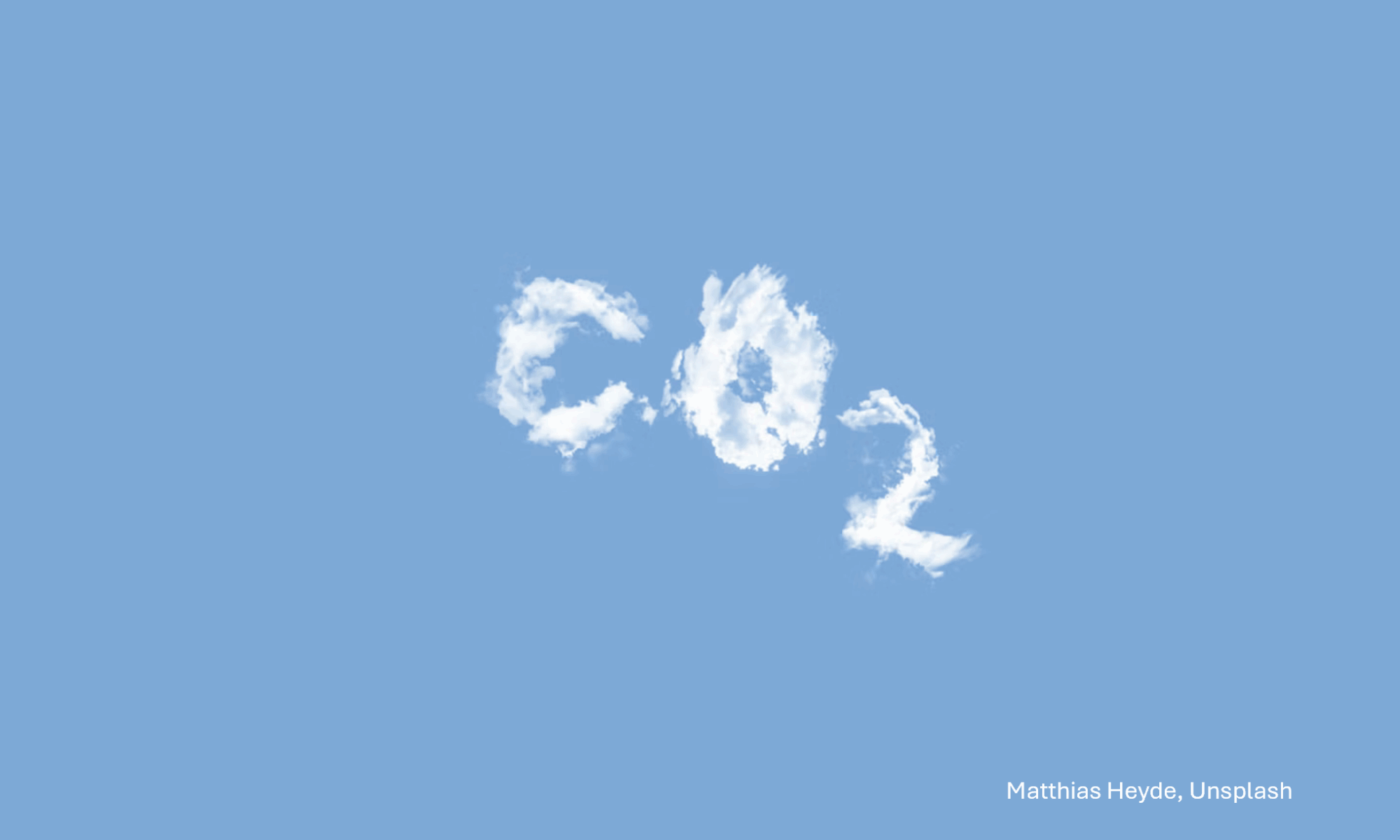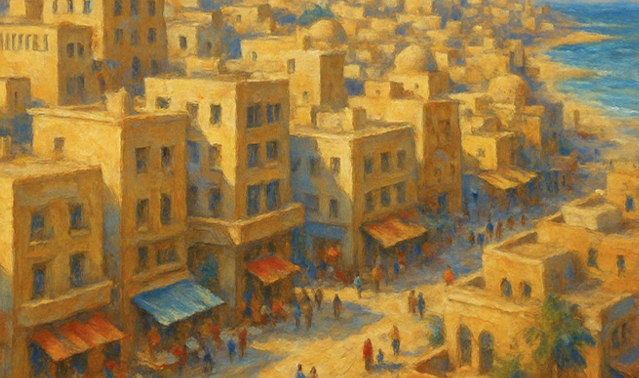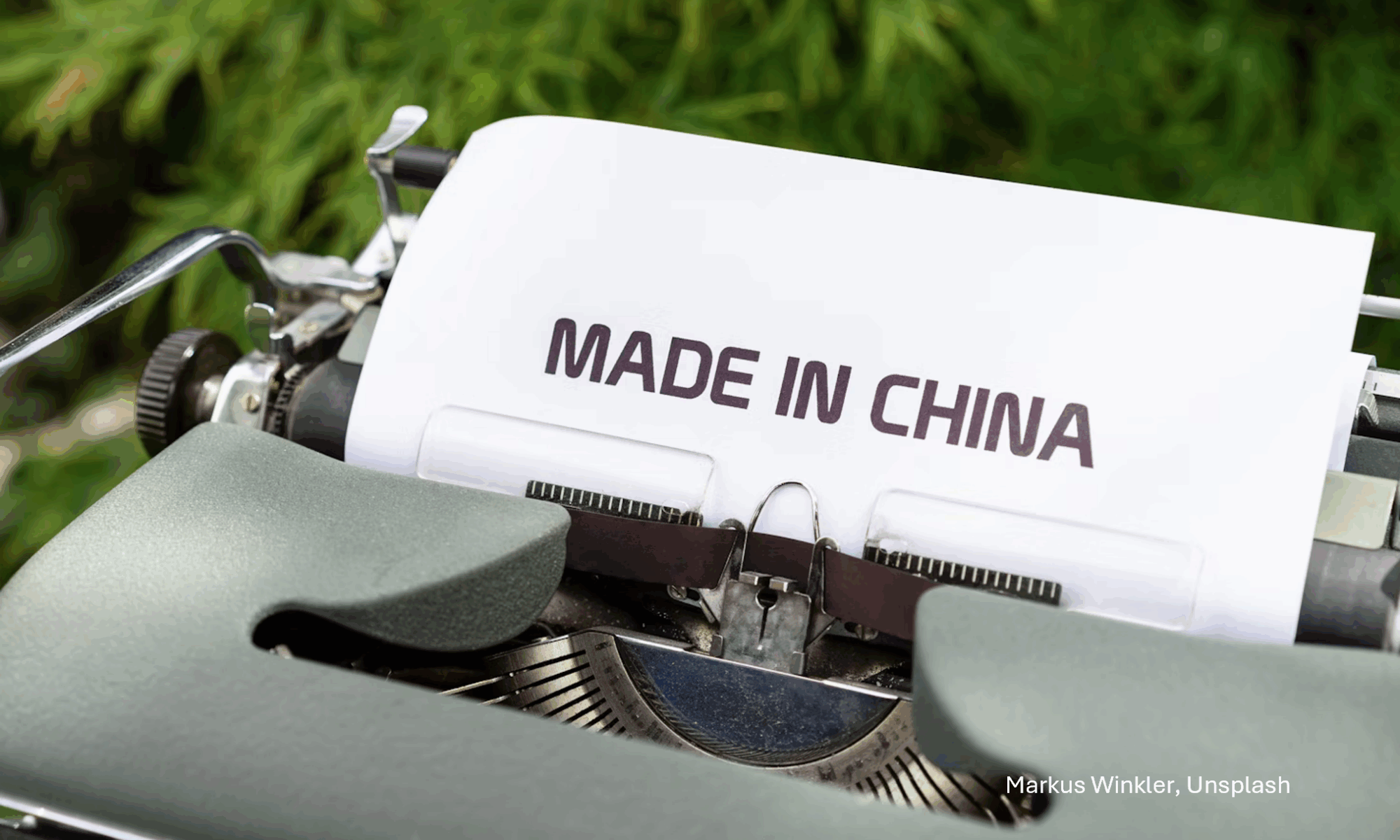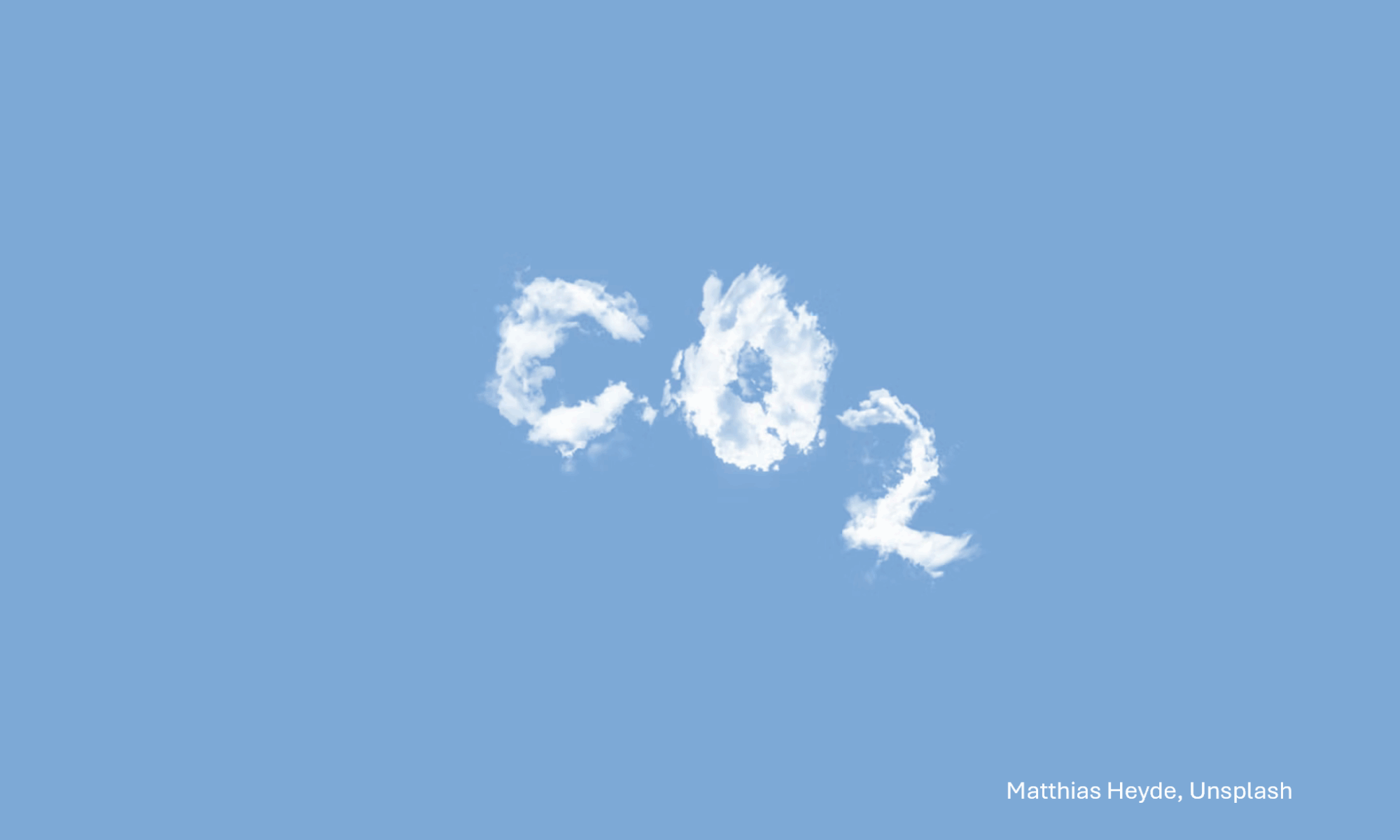Ökonomie in Bildern
Wenn Produkte nicht unterscheidbar sind
Warum gibt es so viel Werbung für Wasser, Cola, Bier oder Zigaretten (dort, wo sie nicht verboten sind)? Weil sich diese Produkte innerhalb ihrer Kategorie kaum voneinander unterscheiden.